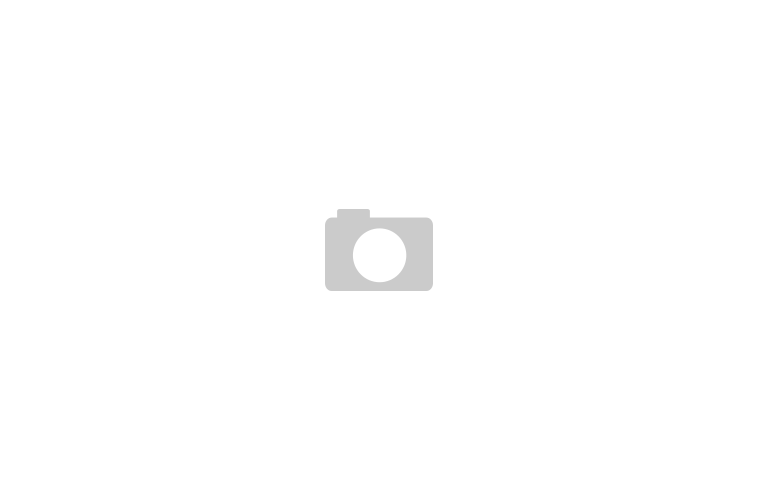Relativ unbeachtet von den überregionalen Medien wird in Wuppertal gerade ein Projekt fertiggestellt, welches – gemessen an seiner Bedeutung für die Stadt, dem Ausmaß des städtebaulichen Eingriffes und der Komplexität der Planung – als Großprojekt bezeichnet werden kann: der Umbau des Hauptbahnhofs und angrenzender Bereiche der Innenstadt. Seit der Autor Wuppertal als Student kennenlernte, waren für ihn der Bahnhof und seine Umgebung abschreckend.
Zugreisende wurden an einem historischen, jedoch durch An- und Umbauten entstellten und völlig verwahrlosten Bahnhofsgebäude empfangen. Davor fand man sich auf einem großen Parkplatz wieder, das Stadtzentrum lag etwa 20 Meter tiefer – unerreichbar wegen einer 150 Meter breiten Verkehrsfläche mit monströsen Serpentinen und einer achtspurigen Bundesstraße. Um ins Zentrum zu kommen, musste man durch einen steilen, dunklen, 150 Meter langen, schauderhaften Fußgängertunnel laufen. Der Tunnel diente ebenfalls als Zugang zum Busbahnhof, der mitten auf der Bundestraße lag, umspült vom Verkehr. Barrierefreiheit war ein Thema von gewisser Brisanz – nicht nur wegen chronisch defekter Rolltreppen. Einem Rollstuhlfahrer, der den Bahnsteig von Gleis 1 erreichen wollte, hätte besser ein Taxi gerufen: mangels Aufzug wäre der einzige barrierefreie Weg zu Gleis 1 über den Parkplatz gewesen – über die monströsen Serpentinen und die achtspurige Bundesstraße.
Dabei begann die Geschichte sehr vielversprechend. Wuppertal (damals noch Elberfeld) wurde, als eine der Wiegen der Industrialisierung in Deutschland, sehr früh durch den Bahnverkehr erschlossen. Das elegante, klassizistische Bahnhofsgebäude von 1848 lang anfänglich noch außerhalb des Stadtzentrums, jenseits der Wupper. Doch am Ende des Jahrhunderts war der Bahnhof bald selbst zu einem Zentrum geworden, umgeben von repräsentativen, öffentlichen Gebäuden, von denen viele den zweiten Weltkrieg jedoch nicht überlebten. Nach dem Krieg wurde die Not der Zerstörung als Chance begriffen, endlich Ideale der Moderne umzusetzen. Ende der 50er Jahre begann dann der autogerechte Umbau der Bahnhofsumgebung mit einer „Flächensanierung“, die das Bahnhofsgebäude nahezu völlig freistellte, die riesige Fläche zwischen Bahnhof und Wupper zu einer reinen Verkehrsfläche degradierte und Fußgänger in den steilen Tunnel unterhalb der neuen Hauptverkehrsachse entlang der Wupper verbannte. Der Bahnhof wurde zu einem stadträumlich isolierten Verkehrsknotenpunkt.
Verschlimmbesserungen
Im Laufe der Jahrzehnte zeigten sich die Probleme dieser Anlage – anfangs in unattraktiven Flächen, die mehr und mehr verwahrlosten. Die Deutsche Bahn pflöegte den Bahnhof nicht und gab ihn dem Verfall preis. In seiner Funktion als Entrée der Stadt für Pendler und Besucher wurde der Hauptbahnhof zum Symbol des Abstiegs der von Finanzproblemen und Bevölkerungsschwund paralysierten Stadt.
Die Situation war unhaltbar, und nun, da nach zehn Jahren der Planung und einer knappen weiteren Dekade Bauen alles geändert ist, fragt man sich: Wann wurde je etwas in einem solch monumentalen Maßstab verschlimmbessert? Mit immensem Aufwand wurde die lange ersehnte oberirdische Fußgängeranbindung geschaffen, aber ansonsten wiederholten sich alle Fehler der Vergangenheit. Das Ideal der autogerechten Stadt wurde mitnichten hinterfragt, die Bundesstraße mit der Tieferlegung in ihrem segmentierenden Autobahncharakter sogar noch ausgebaut. Die Fußgängerbrücke darüber verschleiert diese Misere lediglich partiell. Die Funktionstrennung von Autoverkehr und Fußgängern einfach umzukehren, kann keine befriedigende Lösung sein. Nach wie vor gibt es riesige Verkehrsflächen (wenn auch nicht mehr nur für Fahrzeuge) und schlecht bespielbare, unattraktive Plätze. Durch die Ausdifferenzierung des Bahnhofsvorplatzes in zwei Ebenen sieht manches besser aus, konzeptionell aber verschärft sich das stadträumliche Problem.
Shoppen, shoppen, shoppen
Dem Bahnhofsgebäude wurde ein manierierter Solitär mit Einzelhandelsflächen zur Seite gestellt. Ob der vorgesehene Ankermieter Primark jedoch Attraktion genug ist, um die gesamte Umgebung nachhaltig zu beleben, darf bezweifelt werden. Überhaupt fragt man sich, was ein Solitär hier zur Reparatur des Stadtgefüges beitragen kann. Der letzte bestehende Anschlusspunkt, der Altbau der Bundesbahndirektion, ist tragischerweise jetzt durch meterhohe Spundwände komplett dem Stadtgeschehen enthoben. Das Gleiche gilt für das historische Empfangsgebäude, unter dem man in einer Mall empfangen wird. Als Gipfel der Enttäuschung hat die DB nun nicht, wie angekündigt, begonnen, das desolate Bahnhofsgebäude zu sanieren, sondern versucht es zu verkaufen. Hätte man nicht für einen Bruchteil der Kosten den Fußgängertunnel und das Bahnhofsgebäude radikal sanieren können?
Nächster Versuch
Wohl kaum. Inzwischen entwickelte sich die komplexe Planungsgeschichte tatsächlich mit einer radikalen Vision weiter, die zugleich einen Versuch der Stadtreparatur darstellte: Ein Wettbewerb brachte im Jahr 1999 ein Konzept hervor, das aus der Not der bewegten Topografie Wuppertals eine Tugend machte und vorsah, Bahn- und Busbahnhof zu stapeln. Auf dem dadurch gewonnenen kostbaren Platz hätte substantielle bauliche Masse entstehen können – ausreichend, um aus dem Bahnhofsbereich wieder einen veritablen eigenen Ort werden zu lassen, ein Bahnhofsquartier. Dieser neue Ort sollte oberirdisch mit einer Brücke an die restliche Innenstadt angebunden, die Bundesstraße darunter am Bahnhofsbereich vorbei geführt werden. Wesentliche Elemente des umgesetzten Projektes sind in diesem Konzept bereits enthalten. Auf die Erkenntnisse einer vertieften Machbarkeitsstudie (2003) folgte dann ein städtebaulicher Realisierungswettbewerb (2004) – die Idee des gestapelten (Bus)Bahnhofs war inzwischen aus Kostengründen allerdings längst verworfen.Der Gewinnerentwurf von JSWD aus Köln begnügte sich weitgehend damit, Raumkanten zu ordnen und eine gewisse Übersichtlichkeit und Klarheit in das Areal zu bringen. Durch den Flächenbedarf des Busbahnhofs war das einstige Ziel der Planung, das Bahnhofsquartier, auf eineinziges voluminöses Gebäude geschrumpft – dem Zeitgeschmack entsprechend als leuchtende Ikone auf dem Hügel konzipiert. JSWD stiegen im weiteren Verlauf aus dem Projekt aus; mancheQualitäten ihres Entwurfes wurden in der Ausarbeitung weiter kompromittiert.
Handelt es sich hier um ein Beispiel für eine hochkomplexe Planung, die mit jedem Schritt schlechter wurde, da im Prozess keine Einigkeit über die kritischen Punkte bestand? Oder weil sie schlicht von der Realität der finanziellen Möglichkeiten eingeholt wurde?Heutzutage herrscht eine allgemeine Skepsis gegenüber Projekten dieser Art, die den großen Wurf anstreben, die große Lösung. Aber man macht es sich zu leicht, das Projekt allein deshalb als fehlgeleitet abzutun. Vielleicht muss man das Ganze abstrakter sehen – im Kontext der Ambivalenzen und inhärenten Schwierigkeiten des Versuchs, sich den städtebaulichen „Bürden“ der Nachkriegszeit einfach zu entledigen. Hier müssen grundsätzliche Fragen gestellt werden:Gibt es überhaupt noch einen realen Bezug zu der Zeit davor? Der städtebauliche Kontext ist oft irreversibel verändert.Wie sehr haben sich die Rahmenbedingungen seit dem mid-century eigentlich geändert? Oft sind die Konditionen der Nachkriegsstadt in erschreckend vielen Bereichen kaum andere, als die der zeitgenössischen.Und trotzdem wird man das Gefühl nicht los, dass insbesondere die große Rolle des Themas Mobilität, das die letzten hundert Jahre der Stadtplanung geprägt hat, wie kaum ein anderes, zu wenig reflektiert wurde. Man hat sich zum Sklaven des Jetzt (mit alle seinem automobilen Wahnsinn) gemacht, ohne Ambitionen oder Vorstellungen einer zukünftigen, geänderten Mobilitätzu formulieren. Die gerade angestoßene Erarbeitung eines ganzheitlichen Stadtentwicklungskonzeptes unter dem Titel „Zukunft Wuppertal“ kommt zumindest in diesem Punkt leider zu spät.Und das nun ist schlussendlich das Problem der radikalen großen Lösungen: Die hier geschaffenen baulichen Fakten sind derart umfänglich, dass man sie nur mit ähnlich massiven Eingriffen je wieder wird modifizieren können. Die Toleranz für Irrtum ist gering. Erschreckend ist, dass der Umbau der 50er in seiner Brutalität wesentlich konsequenter war – durch die Fokussierung auf eine (dogmatische) Zukunftsvision, die heute offenbar fehlte. Schlimmstenfalls sehen wir hier eine Planung, die nicht nur anachronistisch aussieht, sondern in weit weniger als 60 Jahren schon obsolet ist.Natürlich ist Wuppertal nicht die einzige deutsche Stadt, die sich an ihrem Nachkriegserbe abarbeitet. Stuttgart und Köln ringen genauso um die verträgliche Integration ihrer überdimensionierten Verkehrsadern, um nur zwei Städte von vielen zu nennen. Hoffen wir, dass die Fehler von Wuppertal hier nicht wiederholt werden.
Bei aller berechtigter Kritik an diesem Projekt, ist Wuppertal aber auch eine Stadt mit großem Potential, die gerade über das Tal eines langen Abwärtstrends hinweg ist und dank günstiger demographischer Trends endlich wieder mit vorsichtigem Optimismus in die Zukunft blicken kann. In diesem Sinne bleibt zu hoffen, dass die Aufbruchsstimmung, die von diesem Projekt ausgeht, weiter strahlt, wenn der architektonische Ärger verflogen ist. Dass die Wuppertaler Bürger das Beste machen aus diesem merkwürdigen Ort, ihn annehmen und aneignen.AbbildungenBild 1:Quelle: zeitgenössische Ansichtskarte, Verlag Hubert Knappe, Düsseldorf.Bild 2 & 3: Quelle: Mahlberg, Hermann J.; Nußbau, Hella (Hrsg.): Der Aufbruch um 1900 und die Moderne inder Architektur des Wuppertales. Wuppertal, 2008.Bild 4: Quelle: Stadt Wuppertal.Bild 5-14: Quelle: eigene Aufnahmen (neu anzufertigen!)