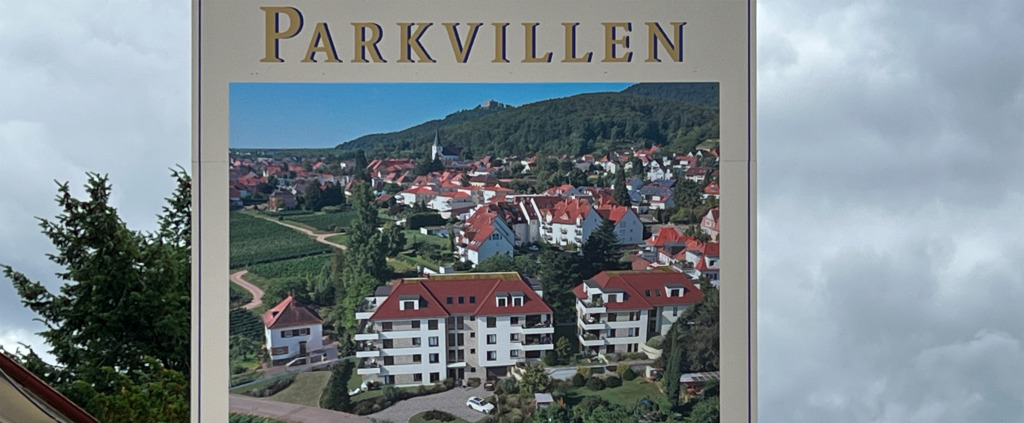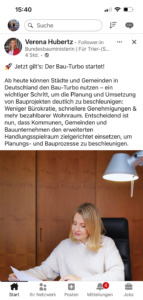Es ist soweit: Der Bau-Turbo wurde am 9. Oktober vom Bundestag mit den Stimmen von CDU und SPD beschlossen, am 17. Oktober hat er auch den Bundesrat erfolgreich passiert. Er ist „gezündet“, wie es die Bundesministerin Hubertz bildhaft formuliert. Ein, wie man leider feststellen muss, seit 2015 mit der sogenannten „Flüchtlingskrise“ nicht mehr beispielloses Gesetzgebungsverfahren hat damit seinen (vorläufigen?) Abschluss gefunden. Wird damit die Brechstange zum Synonym einer neuen Art von Stadtentwicklung?
Es ist soweit: Der Bau-Turbo wurde am 9. Oktober vom Bundestag mit den Stimmen von CDU und SPD beschlossen, am 17. Oktober hat er auch den Bundesrat erfolgreich passiert. Er ist „gezündet“, wie es die Bundesministerin Hubertz bildhaft formuliert. Ein, wie man leider feststellen muss, seit 2015 mit der sogenannten „Flüchtlingskrise“ nicht mehr beispielloses Gesetzgebungsverfahren hat damit seinen (vorläufigen?) Abschluss gefunden. Wird damit die Brechstange zum Synonym einer neuen Art von Stadtentwicklung?
Gemeinwohl?
Für die Parteien der Regierungskoalition rücken die Anliegen einer nachhaltigen Stadtentwicklung in die zweite oder dritte Reihe. Insbesondere die SPD scheint mit Hans-Jochen Vogel ihre früher verfolgten Ziele einer gemeinwohlorientierten, nachhaltigen Stadtentwicklung, insbesondere der gemeinwohlorientierten Bodenordnung, begraben zu haben. So ist es mindestens bemerkenswert, dass sie für die Sachverständigenanhörung im Bundestagsausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen am 10.9.2025 neben der Präsidentin des deutschen Mieterbundes, Melanie Weber-Moritz, als zweite Sachverständige ausgerechnet die Hauptgeschäftsführerin des Zentralen Immobilien Ausschusses (ZIA), Aygül Özkan (CDU), benannte.
Mit der Brechstange
Bezeichnend für das inzwischen bedauerlicherweise übliche Verfahren ist die unvertretbar kurze Rückäußerungsfrist im Rahmen der „Verbändebeteiligung“, die eine fundierte Stellungnahme kaum noch ermöglicht. Da scheint es auch keine Rolle zu spielen, dass der Nationale Normenkontrollrat (NKR) schon mehrfach ein solches Vorgehen bemängelt hat und auch in seiner Stellungnahme zum Entwurf des “Bau-Turbo“ erklärt: „Der NKR kritisiert die Frist zur Stellungnahme von drei Werktagen zwischen der Einleitung der Ressortabstimmung und der Kabinettbefassung und fordert das Ressort auf, trotz der beabsichtigten raschen Umsetzung des Koalitionsvertrages die Grundsätze guter Rechtsetzung zu achten und angemessene Beteiligungsfristen einzuhalten.“ Kurz: Es kommt einem fast unweigerlich das Bismarck zugeschriebene Aperҫu in den Sinn: „Mit Gesetzen ist es wie mit der Wurst. Beim Entstehungsprozess sollte man besser nicht dabei sein.“
Zu den „Grundsätzen guter Rechtsetzung“ gehörte es in der Regel früher auch, zuletzt bei der Novelle 2023-2024, die beabsichtigten Gesetzesinhalte vor der Verabschiedung einem Praxistest in Form eines Planspiels zu unterwerfen und auf Basis der Erfahrungen gegebenenfalls Veränderungen vorzunehmen. Auch darauf wurde beim “Bau-Turbo“ verzichtet. Inwieweit ein am 17. Oktober im Hybrid-Format gestartetes „Umsetzungslabor“ als Element eines Umsetzungsdialogs eine Ersatzfunktion übernimmt, bleibt abzuwarten. Einbezogen sollen dabei die Ergebnisse einer vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im September durchgeführten Kommunalbefragung. Anpassungen eines Gesetzes ex post, so sie denn überhaupt vorgenommen werden, sind immer aufwändiger als eine Korrektur vor Gesetzesbeschluss.
Ungeachtet dessen bekundet die Ministerin Zuversicht. „Wir haben mit dem Bau-Turbo ein neues und mutiges Instrument, das unser Land voranbringen wird.“ Sie sieht sich und ihr Ministerium in einer Pionierfunktion im Hinblick auf die Entbürokratisierungsziele der Koalition, wie in dem oben genannten „Umsetzungslabor“ zu hören war. In diesem Sinn versteht sie wohl auch die Funktion des „Bau-Turbos“, die sie bei derselben Gelegenheit mit „Brechstange“ beschreibt. Der Begriff findet im übertragenen Sinn auch in anderen Bereichen, unter anderem im Sport Verwendung. Dort bezeichnet er, zum Beispiel im Fußball, allerdings die Hilflosigkeit, spielerische Mittel zu finden, um ein Spiel erfolgreich zu gestalten. Statt durchdachter Spielzüge wird der Ball konzeptionslos in Richtung Tor des Gegners geschlagen – in der Hoffnung, mit Glück zum Ziel zu kommen. Gewisse Parallelen zum Agieren der Bundesregierung auf dem Feld der Wohnungspolitik wird man nicht von der Hand weisen können. Insofern passt der Begriff dann doch.

Städtebau war auf gutem Wege: Informationen zur inzwischen neuen Leipzig-Charta > hier.
Ade Leipzig-Charta?
Zu befürchtende Folgen für eine nachhaltige Stadtentwicklung sind im Rahmen der Verbändeanhörung von eeinigen Institutionen plausibel geschildert worden. Sie sind auf der Web-Site des Ministeriums nachlesbar, darauf sei für detailliertere Informationen verwiesen. Deutlich wird, dass die Bundesrepublik – wie aktuell in anderen Handlungsfeldern auch – die Ziele einer gemeinwohlorientierten, nachhaltigen (Stadt-) entwicklung und damit auch die Transformation zugunsten der Klimaziele als nachrangig ansieht – wenn nicht sogar, zumindest teilweise, zur Disposition stellt. Eine Schwächung der Prinzipien der Neuen Leipzig-Charta ist nicht auszuschließen – diese wurde von der Bundesrepublik initiiert und mitbeschlossenen. „Ihre [der Leipzig Charta] Relevanz ergibt sich aus der Verpflichtung der sie verabschiedenden Ministerinnen und Minister, nationale Stadtentwicklungspolitiken zu betreiben, die den Prinzipien der Charta folgen und sie in konkrete Initiativen umsetzen“, formuliert das Ministerium selbst als Grundsatz, der nun in Frage gestellt wird.
Zu den inhaltlichen Problemen kommen „Fragezeichen“ hinsichtlich der Praktikabilität und damit zusätzliche Zweifel an der Wirksamkeit des nun beschlossenen Gesetzestextes. Schon die Klärung der Zuständigkeit für die Erteilung des Einvernehmens beziehungsweise der Zustimmung in den Gemeinden wird interessant sein zu beobachten. Was ist „laufendes Geschäft der Verwaltung“, was ist Aufgabe des Stadtrats? Dies auch vor dem Hintergrund, dass angesichts der erheblichen Erleichterungen in den §§ 31 Abs.3 BauGB n.F., 34 Abs.3b BauGB n.F. und 246 e BauGB n.F. das Konfliktpotenzial von Projekten nicht unerheblich steigen dürfte – mit der Folge einer höheren Wahrscheinlichkeit von „Diskussionen“ mit Nachbarn und der Stadtgesellschaft.
Wird nun alles „einfacher“?
Desweiteren spricht einiges dafür, dass die Einschätzung, ob ein Projekt, das unter Inanspruchnahme von § 31 Abs.3 BauGB n.F., § 34 Abs.3a BauGB n.F oder § 246e genehmigt werden soll, „unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit den öffentlichen Belangen vereinbar “ ist oder nicht, je nach Genehmigungsbehörde beziehungsweise Gemeinde nicht selten differieren wird. Gleiches gilt für die Frage, ob ein Projekt bei Inanspruchnahme von § 246e BauGB im Außenbereich der Anforderung des „räumlichen Zusammenhangs“ mit Flächen genügt, „die nach § 30 Abs.1, Abs.2 BauGB oder § 34 BauGB zu beurteilen sind“. Der seit langem beklagte Umstand, dass die Landesbauordnungen in den 16 Bundesländern in einigen Punkten differieren und damit mehr Aufwand und -Kosten verbunden sind, dürfte im Vergleich dazu schon fast eine Petitesse darstellen. Hinzu kommt dann noch die Unsicherheit, ob die jeweiligen Einschätzungen einer gerichtlichen Überprüfung gegebenenfalls standhalten. Nicht umsonst stellt der NKR fest: „Durch präzise und einheitliche Vorgaben kann der Vollzug maßgeblich vereinfacht und Verfahren dadurch drastisch beschleunigt werden“.
Die Kommunen sollen’s richten
Den „Schwarzen Peter“ haben nun wohl die Kommunen. Die Koalition ist offensichtlich frohen Mutes, ihre Aufgaben bei der notwendigen Schaffung von (bezahlbarem) Wohnraum erledigt zu haben, wie Redebeiträgen in der abschließenden Bundestagssitzung zu entnehmen ist. „Der Bund (…) liefert [mit dem Bau-Turbo, Erg. d. Verf.] die Rahmenbedingungen. (…) Die Länder schreiten mit voran. Die Kommunen entscheiden und setzen um. (…) Das ist mein Angebot … für Möglichmacher.“ So die Ministerin. „Die Kommunen haben es jetzt in der Hand. Wir geben den Kommunen alle Mittel an die Hand, die sie benötigen, um den Mangel an bezahlbarem Wohnraum zu beheben“ – assistiert MdB Jan-Marco Luczak für die CDU/CSU. Es wird abzuwarten sein, wie die Kommunen den Spagat zwischen Druck von Investoren, Politik und Medien einerseits und der Realisierung einer nachhaltigen, gemeinwohlorientierten Stadtentwicklung andererseits bewältigen.
Erinnert sei an das in der zweiten Hälfte der 1980er und in den 90er Jahren verfolgte Planungsmethodenmodell der „inkrementalistischen Planung“ und ihrer Weiterentwicklung, der „projektorientierten Planung“. Die Ambivalenzen des letztgenannten Planungsansatzes haben Siebel et al. bereits 1999 anhand der IBA Emscher Park untersucht und unter anderem formuliert: „Projektförmig organisierte Planung ergänzt die klassischen staatlichen Steuerungsformen, kann aber nicht an deren Stelle treten.“ Man sollte sich diese Erfahrungen einmal wieder vergegenwärtigen, bevor entsprechend dem von der Ministerin im Bundestag geäußerten Motto: „Bauen ohne lange zu reden, sondern loslegen, dort wo es geht“, gehandelt wird.
Es erstaunt, dass mittel- bis langfristig orientierte Immobilienakteure, soweit erkennbar, keine Probleme mit dem Bau-Turbo haben. Sie verlieren erheblich an Sicherheit, was im Umfeld ihrer Bauobjekte geschehen kann. Bebauung grüner Innenhöfe (eventuell erst mit erheblichen Steuergeldern im Rahmen der behutsamen Stadterneuerung entstanden), Bauten auf dem Nachbargrundstück, die in ihrem Volumen das eigene Objekt (erheblich) übertreffen und, im Extremfall, sogar die Bebauung von im Bebauungsplan festgesetzten Grün- beziehungsweise Freiflächen. Dadurch wird die Attraktivität eines Quartiers negativ beeinflusst und die Gefahr einer Wertminderung des eigenen „Objekts“ größer. Es kann also eine Gruppe von „Benachteiligten“ und eine Gruppe von „Profiteuren“ entstehen. Nicht ausgeschlossen, dass erstgenannte Gruppe durch Beschreiten des Klageweges versucht, ein Projekt zu verhindern oder aber (finanzielle) Kompensationen durch Vereinbarungen mit dem Projektentwickler zu erreichen. Folgen wären in jedem Fall Verzögerungen und Kostensteigerungen. Interessant wird es auch sein, wie die Kreditwirtschaft auf solche Entwicklungen/Unsicherheiten reagiert. In Einfamilienhausgebieten wird die erleichterte Möglichkeit, in zweiter Reihe zu bauen, nicht unbedingt das nachbarschaftliche Miteinander fördern.
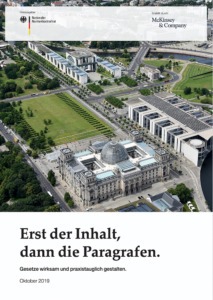
NKR-Gutachten, 2019 (> online hier)
Abschließend sei noch einmal aus einem Gutachten des NKR, in diesem Fall aus dem Gutachten „Erst der Inhalt, dann die Paragrafen. Gesetze wirksam und praxistauglich gestalten“ aus dem Jahr 2019, zitiert: „Der tatsächliche Erfolg eines Gesetzes – und daher auch seine Güte – hängt … entscheidend davon ab, ob der Gesetzgeber das zu lösende Problem richtig erfasst hat und das Gesetz an der richtigen Stelle ansetzt, also davon, ob es überhaupt eine positive Wirkung erzielen kann oder womöglich sogar negative Nebenwirkungen erzeugt.“