Wenn (Natur-)Wissenschaftler nach dem Abschluss ihres Berufslebens belletristisch arbeiten, bringen sie eine gute Voraussetzung mit: Sie können exakt beobachten und analysieren. Großartig, wenn sie auch noch über Sprachgefühl und eine ironische Begabung verfügen. Bei Gerd de Bruyn trifft das alles zu.
 Gerd de Bruyn: Bremens letzte Jahre. 176 Seiten, Format 12 x 19 cm, edition staub, ISBN 978-3928249850, 12,90 Euro.
Gerd de Bruyn: Bremens letzte Jahre. 176 Seiten, Format 12 x 19 cm, edition staub, ISBN 978-3928249850, 12,90 Euro.Mit diesem Buch beschließt Gerd de Bruyn, vormals Leiter des igma (Institut für Grundlagen Moderner Architektur) in Stuttgart, den Dreisatz erzählter Lebensabschnitte über Jugend und Erwachsensein mit einer Altersgroteske – man findet den Spaziergänger Franz Bremen (58) tot in schäbiger Kleidung krumm und quer auf einem Weg liegend. Man könnte dieses Ereignis als endliche Befreiung vom eingesperrten Dasein oder auch als Auftakt ewiger Sündenstrafen betrachten, denn es konterkariert drastisch sein kauziges Leben.
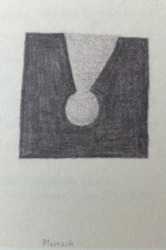 Bremen war ein Pedant, der sich bei gleichzeitiger Verwahrlosung seiner Umgebung eine präzise Ordnung installiert hatte. In seiner Wohnung mussten sich die unverrückbar fixierten Möbel präzise an Fluchtlinien halten, und damit sie dieser rechtwinkligen Räson folgen konnten, hatte er sogar ihre Fronten geglättet und Profile, Leisten und störende Konturen entfernt. Natürlich fallen einem zur Warnung Architektenkollegen ein, denen man irgendwann begegnet ist, vielleicht handelt es sich bei Bremens Marotten für ein „Kunst- und Lebensreformwerk“ auch um die fehlgeleitete Ambition, mit der Ludwig Wittgenstein das berühmte Haus für seine Schwester entworfen hat.
Bremen war ein Pedant, der sich bei gleichzeitiger Verwahrlosung seiner Umgebung eine präzise Ordnung installiert hatte. In seiner Wohnung mussten sich die unverrückbar fixierten Möbel präzise an Fluchtlinien halten, und damit sie dieser rechtwinkligen Räson folgen konnten, hatte er sogar ihre Fronten geglättet und Profile, Leisten und störende Konturen entfernt. Natürlich fallen einem zur Warnung Architektenkollegen ein, denen man irgendwann begegnet ist, vielleicht handelt es sich bei Bremens Marotten für ein „Kunst- und Lebensreformwerk“ auch um die fehlgeleitete Ambition, mit der Ludwig Wittgenstein das berühmte Haus für seine Schwester entworfen hat.
Als Beruf gab Bremen den altertümelnden Begriff „Geometer“ an, seinen Unterhalt bestreitet er jedoch aus der bescheidenen Lebensversicherung seiner verstorbenen Frau. Er geht ins Café Schumann und trifft sich mit einem Debattierzirkel in den Wielandstuben, doch pflegt er keine Freundschaften und wird zum Ausgleich rätselhaft von allerlei Getier heimgesucht. Einer Verführung durch eine Kaffeehausbekanntschaft weiß er sich zu entziehen. Man darf sicher sein, dass de Bruyn neben den Seitenblicken auf die Architektur seinem Bremen einiges mitgegeben hat, was ihn selbst lästig begleitet: der Dudelfunk des Radioprogramms, die alberne Hampelei des Tanzens oder der Gruppenzwang verordneter Freizeitbetätigungen. Viel ereignet sich nicht in der knappen Geschichte, man hätte sie gut mit einem zweiten spannenden Erzählstrang verschneiden oder die Handlung ins Absurde zuspitzen können. Aber manchmal mag man sich als Leser auch gerne der Nahaufnahme eines Hintergrundrauschens widmen.
 An Bremens Erdenleben schließt sich seine (vorübergehende) Existenz als Schattenwesen an. Es ist noch nicht die Ewige Seligkeit, aber der Verstorbene ist mit dem erreichten Zustand bereits zufrieden, hatte er sich doch schon im Diesseits ahnend mit einem Gefühl für das Judentum und einem mönchischen Habitus angefreundet. Die Welt ist also nicht das Letzte, gibt uns der Autor mit. Wie er den Aufenthalt beschreibt in dieser somnambulen Umgebung, in der Bremen seine Frau wiedertrifft, mit der er zusammenbleiben möchte, „bis sie verglimmen“, erinnert an die Fabuliereinfälle eines Herbert Rosendorfer. De Bruyn beschließt seine Vision dieser Schattenwelt mit einem gezeichneten Zugabenteil aus Girlanden und Proportionsstudien.
An Bremens Erdenleben schließt sich seine (vorübergehende) Existenz als Schattenwesen an. Es ist noch nicht die Ewige Seligkeit, aber der Verstorbene ist mit dem erreichten Zustand bereits zufrieden, hatte er sich doch schon im Diesseits ahnend mit einem Gefühl für das Judentum und einem mönchischen Habitus angefreundet. Die Welt ist also nicht das Letzte, gibt uns der Autor mit. Wie er den Aufenthalt beschreibt in dieser somnambulen Umgebung, in der Bremen seine Frau wiedertrifft, mit der er zusammenbleiben möchte, „bis sie verglimmen“, erinnert an die Fabuliereinfälle eines Herbert Rosendorfer. De Bruyn beschließt seine Vision dieser Schattenwelt mit einem gezeichneten Zugabenteil aus Girlanden und Proportionsstudien.


