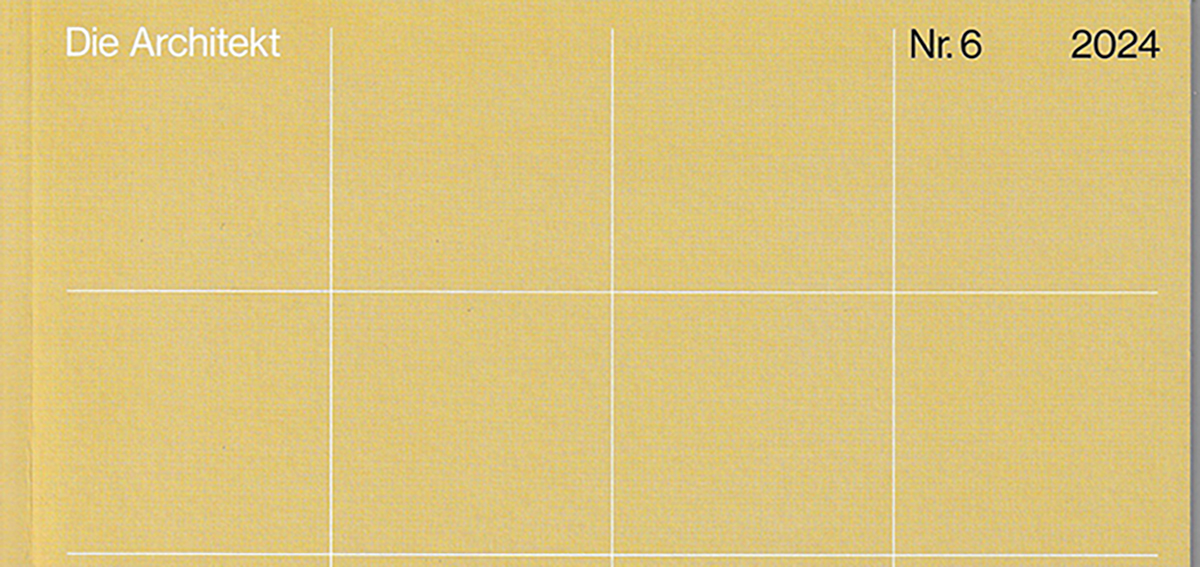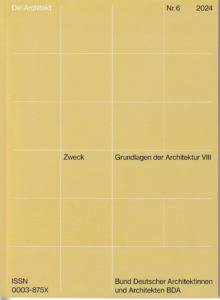In bürokratischen und publizistischen Bereichen – beispielsweise amtlichen Meldungen oder auf tagesschau.de – ist „einfache Sprache“ inzwischen verpflichtend. Jeder und Jede soll in Zeiten zunehmender Leseschwächen verstehen können, worum es geht. Nur in wissenschaftlicher Umgebung liegt die Sache anders: Fachchinesisch als wortgebundene Besonderheit wird inzwischen ergänzt von teils abstrus, weil unverständlich formulierten Gedankengängen, mit denen eine unnötige Metaebene über die Fachterminologie und die Diskursthemen gelegt wird. Wer dächte dabei nicht auch an „Geschwurbel“, das vor allem in Geisteswissenschaften immer wieder beklagt wird. Zum Beispiel in der Architekturtheorie.
Als dankbarer Freibezieher von Die Architekt plage ich mich immer wieder mit einzelnen Beiträgen. Es gibt wenig Erheiterndes zu lesen, keine scharfsinnige Ironie oder einladend formulierte literarische Essays. Stattdessen erhält man bisweilen ein bedeutungsschweres Repetitorium, als müssten sich ArchitektInnen zu Sterndeutern qualifizieren. Wie es in Heft 6/24 Uwe Schröder versuchte. Er baut – wenn man das einmal so gönnerhaft sagen darf – sehr ordentliche Häuser. Ihre Architektur lebt von einer romantischen Koketterie mit der Baugeschichte, irritiert weder mit harscher Moderne noch mit leutseliger Nostalgie.
Damit schafft sie es, sowohl bei arrivierten Fachleuten als auch beim architekturfernen Publikum Anerkennung zu gewinnen. Bei Heinz Bienefeld (1926-1995), Arno Lederer (1947-2023) und Andreas Hild (Jahrgang 1961) ließe sich eine vergleichbare Balance feststellen. Uwe Schröder (Jahrgang 1964) kann mittlerweile eine stupende Hochschulkarriere in Deutschland und Italien vorweisen, er war bis 2024 im Redaktionsbeirat des BDA-Periodikums „Die Architekt“ und meldet sich dort hin und wieder zu Wort.
Topologie, Typologie
Zuletzt setzte er sich mit Topologie und Typologie auseinander. Ein anstrengender Diskurs, der die Frage aufgibt, ob man ihn als Voraussetzung benötigt, um genau diese Häuser zu bauen, wie sie Schröder gelingen. Um eine Vermutung vorwegzunehmen: Ich glaube, die Redaktion hat sich geweigert, sein Manuskript zu redigieren. Oder ist daran gescheitert und hat es einfach abgedruckt. Mich erinnert es an eine vergleichbare Anstrengung mit Jörg Gleiters Thesen, die ich mir ebenfalls nicht als süffige Pflichtlektüre für Architekten vorstellen kann. Vermutlich herrscht im BDA eine Interessenverteilung, die meisten Kollegen sind froh, wenn andere ihren Verein mit der Aura eines theorieträchtigen Berufsverbands umwölken, damit sie sich selbst wieder dem heiteren Tagesgeschäft mit Stellplatznachweisen und Gipserausschreibungen zuwenden können.
Verfasstheit, Eigenschaftlichkeit, gedanklicher Ausdruck …
Doch zu Schröders Beitrag. Er erschien zum Abschluss der Staffel „Grundlagen der Architektur“ und korrespondierte mit der jährlich an der RWTH in Aachen stattfindenden Tagung „Identität der Architektur“, wobei dort „Architekten im Betreff ihrer Bauten nach der jeweiligen Bedeutung der grundlegenden Begriffe für das Entwerfen und Bauen gefragt werden“. Und hier stock‘ ich schon. Was ist das für eine sprachliche Knüppelstrecke: „im Betreff ihrer Bauten“? Doch es wird nicht besser. Oft fällt ein Begriff, aber er wird erst später gedeutet, dazwischen sind hilfsweise orientierende Fragen eingestreut, die nicht beantwortet werden. Anstelle von beweglichen Verben wuselt es von Substantiven, die scheinbar beliebig miteinander verknüpft oder in Wortkaskaden gereiht sind („kulturell-gesellschaftliche Verfasstheiten“), es hängt ja alles mit allem irgendwie zusammen. An anderer Stelle notierte Schröder die „Verfasstheit des Wohnens“ – was ist das: eine Funktion, ein Zustand, ein Gefühl? Egal, es klingt fast staatstragend, da kennt sich einer aus. Vielleicht sind wir zu kleinlich, wenn wir nachfragen: Wieso ist der Ort der Architektur „immer erst einzuschreiben“ und nicht umgekehrt: die Architektur dem Ort? Oder: Ein Fest verlangt einen erkennbaren Raum, das ist naheliegend. Aber wie kann der Raum über eine zurückliegende Sause Auskunft geben: durch das verkratzte Parkett, schmutziges Geschirr und herunterhängende Girlanden? Das Beispiel soll die methodisch wechselseitige Transkription erläutern, die Unterscheidung von Topologie (Ort, Zeit und Zweck) „in Abhebung von den Naturwissenschaften“ und von Typologie (Material, Konstruktion, Form, Funktion und Raum), also der „Eigenschaftlichkeit“ eines Gebäudes“. Diese Sinnzusammenhänge zu erkennen werde sowohl bei der „entwurflichen Herangehensweise“ helfen als auch bei der späteren kritischen Auseinandersetzung mit dem Gebauten. Und zwar so: „Die Idee des Entwurfs transkribiert den gedanklichen Ausdruck auf den entsprechenden ästhetischen Eindruck, den Gedanken auf das Gefühl, auf und für die Räumlichkeit der Gebäude.“ Da verstrickt man sich beim Lesen unversehens im Nebeneinander von Paraphrasen und Tautologien, Selbstverständliches wird umständlich in abstrakten Formeln zur Wichtigkeit aufgeblasen. Man könnte ebenso sagen: Das Bedürfnis des Trinkens transkribiert den gedanklichen Ausdruck auf die entsprechende Bestellung, den Gedanken auf den gefühlten Durst, schließlich auf und für die Wahrnehmung einer intakten Zapfanlage in Erwartung eines gepflegten Biers. Auch das ist eine Transkription, die einen nachvollziehbaren Vorgang so sperrig übersetzt, dass man lieber bei Apfelschorle bleiben wird.
Begriffe und Begreifen
Ich bin mir bei Schröders Text nicht sicher, ob es sich um hochmögende Gedanken handelt oder ob der Autor nur dünne Brettchen bohrt und die fragile Stellage mit Begriffen verkleistert. Ich neige zu der zweiten Annahme. What you see is just illusion. You’re surrounded by confusion, haben uns Supertramp gewarnt (1974). Das gilt auch hier. Ich gebe zu, ich bin wieder einmal gescheitert. An Uwe Schröders Bauten könnte ich mich mit Vergnügen sattsehen. Aber seine Begriffsjonglagen sind eine Strapaze für Menschen guten Willens.
Projekt: Haus am Gerottener Weg
Anmerkung/en: [Projekt: Entwurf, Ausführung]
Ort: Rösrath
Jahr: 2018 – 2021
Mitarbeit: Matthias Storch, Timo Steinmann, Jonathan Schmalöer, Michael Weyck
Publikationen: LABORATORIO SULL‘ ABITARE. Forme di case, Ein guter Nachbar