Eine Ausstellung und eine bahnbrechende Publikation zeigen, wie das Bauen mit Eisenbeton um 1900 die Gestalt Wiens grundlegend veränderte. Und nicht nur Wien. Architekturgeschichte heißt, die Dynamik der Transformation zu vergegenwärtigen – als Motivation dafür, für Veränderungen keine Angstszenarien zu priorisieren.
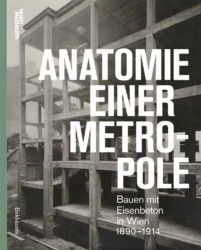
Otto Kapfinger (Hrsg.): Anatomie einer Metropole. Bauen mit Eisenbeton in Wien 1890-1914. Birkhäuser, 2025. 24,7 × 30.5 cm, 378 s/w Abb., 154 farb. Abb. Hardcover. ISBN 978-3-0356-2947-7
Holztäfelung und alte Pölster, grantige Kellner und viel Patina: Das Café Bräunerhof gilt als ein Paradebeispiel für das „alte Wien“ und seine schwermütige Behaglichkeit. Ein Klischee, das unser Bild der Gründerzeitstadt prägt: Historistischer Fassadendekor und schwere Mauern. Doch um 1900 wehte ein Wind der Innovation durch Wien, der die Art des Bauens grundlegend veränderte – und auch die unteren beiden Geschosse des 1910-12 errichteten Bräunerhofs. Denn diese wurden in Eisenbeton errichtet, einer damals neuen Konstruktionsweise, die weite und helle Innenräume ermöglichte.
Den revolutionären Auswirkungen des Eisenbetons widmen sich eine Ausstellung im Wien Museum und die umfangreiche Publikation „Anatomie einer Metropole“, basierend auf der mehrjährigen Arbeit eines Teams um den Architekturforscher und Publizisten Otto Kapfinger. Alles begann, erinnert sich Kapfinger, 2016 mit einem Heureka-Moment an einer Baustelle: Die unteren drei Geschosse eines Gründerzeitbaus waren bis aufs Betonskelett entkernt, die Etagen darüber blieben unangetastet. Das vermeintlich alte Wien zeigte hier sein modernes Knochengerüst hinter der Haut. Der Buchtitel mit seiner Analogie von Stadt und Körper ist zweifellos perfekt gewählt.
Der technische Fortschritt
Der beschleunigende bau- und ingenieurtechnische Fortschritt machte Wien im „window of opportunity“ zwischen 1890 und 1914 zu einer Großstadt des 20. Jahrhunderts. Den Anstoß gab der Eisenbahnbau, wo Ingenieure mit ständig neuen Konstruktionsmethoden für Brücken und Tunnels experimentierten. Beim Bau der Wiener Stadtbahn entstanden hierfür große Versuchsanlagen. Ingenieur-Pioniere wie der von Kapfingers Forschungsteam wiederentdeckte Eduard Ast entwickelten laufend neue Patente, die – heute würde man es „open source“ nennen – sofort öffentlich bekannt wurden, was die Innovation noch weiter beschleunigte.
Bald machte sich diese Start-Up-Dynamik auch im Hochbau bemerkbar, wo sie Hand in Hand ging mit dem Zubehör einer modernen Metropole: Kaufhäuser, Cafés, Kinos und Druckereien. Orte der Aktivität, der Kommunikation, des Nachtlebens. „Hier ging es um performance statt appearance“, erklärt Otto Kapfinger und verortet in dieser kurzen Zeitspanne eine Blütezeit der technischen, unternehmerischen, gestalterischen und künstlerischen Intelligenz.
Österreichische Lösungen
Was Wien so besonders machte: Während Paris um 1900 schon technologisch weiter war und Berlin ausreichend Platz hatte, um sich auszubreiten, musste in Wien das reguläre Raster des Eisenbetons in die bestehende Stadt mit ihren schiefen und engen Parzellen eingepasst werden – kluge Kompromisse, oder, wie man in Wien sagt: „österreichische Lösungen“. „Gerade dadurch wurden Innovation und Intelligenz herausgefordert. Hier die Stadt um- und weitergebaut,“ so Kapfinger. Zahlreiche Fälle dieser Verzahnung von Alt und Neu sind bis heute nahezu originalgetreu erhalten. Darunter sind auf den ersten Blick unauffällige Bausteine der Stadtsubstanz, aber auch architekturhistorische Ikonen wie Jože Plečniks Zacherlhaus (1903-05), das in den ersten Plänen noch als konventioneller Mauerwerksbau vorgesehen war, bevor man auf den Eisenbeton wechselte, dessen Spannweiten auf dem kleinen, schmalen Grundstück deutlich mehr nutzbare Fläche ermöglichten. Wie die umfangreiche Buchpublikation deutlich macht, war dies nicht der einzige Fall, bei dem noch während der Planungsphase das konstruktive Pferd gewechselt wurde – bei der Plan-Auswechslung wurde dadurch quasi der Sprung vom 19. ins 20. Jahrhundert vollzogen. Da viele Architekten und Ingenieure in Personalunion auch Bauherren waren, musste man dafür auch niemanden um Erlaubnis fragen und konnte sofort reagieren, wenn neue Patente auf den Markt kamen.
Urbanität
Diese neue Großstadt-Welt brachte auf allen Ebenen neue Akteure ins Spiel, vor allem aus dem jüdischen Bürgertum – und Frauen, die oft die ersten Lizenznehmerinnen der Kinos wurden. Denn für ein Gewerbe, das soeben erst erfunden wurde, gab es keine Zunft und keine Zugangsbeschränkungen. 150 Kinos entstanden in Wien allein zwischen 1908 und 1914, oft auf räumlich raffinierte Weise in Souterrains und Keller hineingeschoben, da die großen Spannweiten des Eisenbetons viel Spielraum ließen. „Um 1900 stellten Wiens Eisenbetonbauten Raum für ein neues urbanes Leben bereit: Theater, Kinos, Geschäfte, Cafés und Restaurants, Büros und Wohnungen stapelten sich in einem einzigen Gebäude,“ sagt Eva-Maria Orosz, die gemeinsam mit Andreas Nierhaus die Ausstellung am Wien Museum kuratierte, die die Forschungsarbeit mit historischen und neuen Modellen illustriert und mit zeitgeschichtlichen Exponaten ergänzt.
Prachtvolle Paradebeispiele für jene Bauten, die wie eine Stadt in sich funktionierten: Der Residenzpalast am Fleischmarkt, in dem heute noch die Kammerspiele residieren, und das 1916 eröffnete und im 2.Weltkrieg weitgehend zerstörte Dianabad, damals das größte und modernste private Bad Europas, ein „Wellness-Palast“ avant la lettre. Aber auch Geldinstitute wie der Wiener Bankverein am Schottentor, bei seiner Eröffnung 1912 ein monumentaler High-Tech-Bau, machten sich den Eisenbeton zunutze.
Die Lektüre eröffnet so auch für jene, die Wien und seine Baugeschichte ausreichend gut zu kennen glauben, nicht nur eine Fülle an wiederentdecktem Wissen, sondern auch ganz neue Blicke auf das vermeintlich Vertraute. Danach geht man mit anderen Augen durch Wien – auch und gerade an Orten, die zur Genüge bekannt scheinen. Wie die Bilder des Fotografen Wolfgang Thaler zeigen, der die Innenräume der gezeigten Häuser im heutigen Zustand dokumentiert hat, erweist sich das betonierte Gerüst der Großstadt auch nach über 100 Jahren noch als tragfähig.
Eisenbeton: Anatomie einer Metropole, Ausstellung im Wien Museum, bis 28. September 2025


