
Natur? Das Naturschöne ist eine Fiktion, die aus deutscher Romantik überliefert ist. (Bild: Ursula Baus)
Eingeladen waren Namhafte – aus der Politik, aus dem Bauwesen, aus den Frauennetzwerken: Robert Habeck, Werner Sobek, Fabienne Hoelzel. In München hatte die Bayerische Architektenkammer zu einer Debatte unter dem Titel „Die ästhetische Gestaltung der Energiewende“ eingeladen. Eine gute Idee, denn dieses Thema ist zwar nicht neu, aber man kann ihm vieles abgewinnen, was Grundlagenwissen zur Ästhetik mit Aktualität in der Baukunst und Politik verbindet – teils in kausalem Zusammenhang.
Keine Powerpoint-Präsentationen, kein Bildervortrag – das war wunderbar.i Es ging aber schon um „Power“, um Macht, die in derartigen Gesprächsrunden mit Deutungshoheiten und Eitelkeiten konnotiert ist. Es unterhielten sich Ex-Wirtschaftsminister Robert Habeck, Architekt und Bauingenieur Werner Sobek und als „Quotenfrau“ (so bezeichnete sie sich scherzhaft selbst) die Stadtplanerin und Feministin Fabienne Hoelzel. Landschaftsarchitekt Sören Schöbel-Rutschmann moderierte und redete mit.
Windräder und Strommasten
Um einen viertelstündigen Einführungs-Impuls war Robert Habeck gebeten worden – weil er doch immerhin Philosophie und Germanistik studiert und zu einem Thema mit ästhetischem Schwerpunkt promoviert hat.ii Als einstiger Minister für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und Natur in Schleswig Holstein kennt sich Habeck zudem auch in Fragen des Veranstaltungsthemas bestens aus. In seiner Diss bezog er sich im wesentlichen auf die Ästhetik seit Kant und bis Hegel, schlug einen Bogen zu Humboldt und zur Semiotik – eine solide Wissensgrundlage, die sich im Hinblick auf das Veranstaltungsthema anregend ausbauen ließe. Aus den 15 wurden flugs 40 Minuten in freiem Vortrag, aber keine davon langweilig. Denn Habeck wäre nicht Habeck, könnte er nicht auf sein rhetorisches Talent und sein enormes Erfahrungswissen aus Jahrzehnten politischer Praxis vertrauen – in der, so Habeck, „Vernunft als Basis politischer Entscheidungen“ leider nicht die Regel sei. Robert Habeck eignet ein politisches Talent, das derzeit im Lande seinesgleichen kaum findet.iii Denn was der Politik fehlt, die eine Julia Klöckner zu Bundestagspräsidentin macht, ist intellektuelle Kompetenz und Redlichkeit. Die Bundestagspräsidentin verweist keinen, der rechte Parolen brüllt, des Raumes, sondern jemanden, der eine Franzosen-Basken-Mütze trägt. Vernunft überfordert Julia Klöckner.
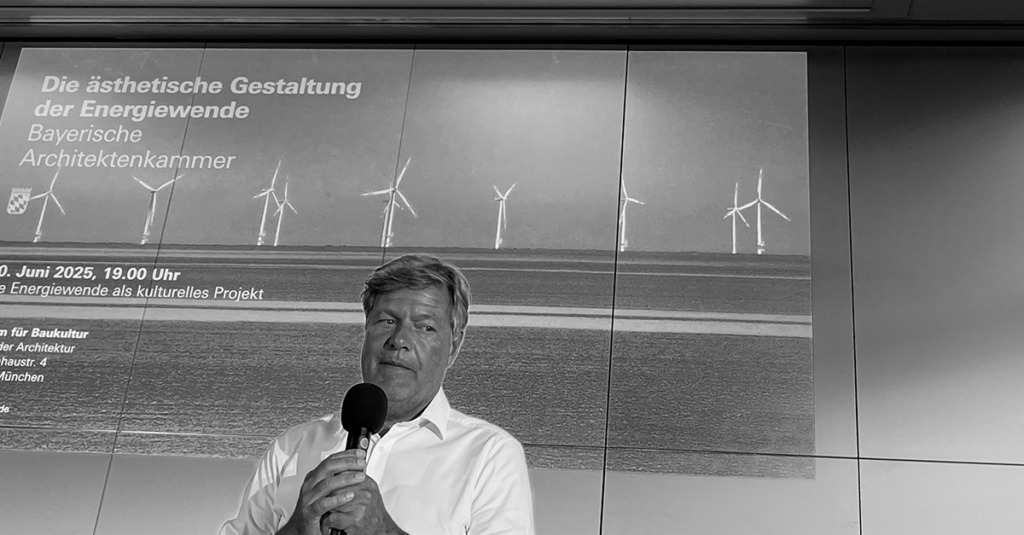
Die Bayerische Architektenkammer hatte als Veranstaltungsbild eine Windräder-Landschaft gewählt, die erkennbar nicht in Bayern ist. (Bild: Ursula Baus)
Ist das „schön“?
Welche Rolle also spielt Ästhetik dafür, dass die Energiewende auf größere Akzeptanz stoßen und an Fahrt aufnehmen kann? Denn die Energiewende scheint primär ein technischer Fortschritt mit Konsequenzen für die notwendige Transformation der Landschaft – und der Gesellschaft zu sein. Mit ästhetischen Folgen, die zu diskutieren vielleicht, so Habeck, „gar keinen Sinn“ habe?
Sein Exkurs zur Geschichte der Ästhetik begann in lockeren Worten bei Kant und endete bei Hegel, wobei man ergänzen darf, dass die (bau-)kunstbezogene Ästhetik dezidiert mit Baumgarten (1714-1762) bereits wissenschaftliche Konturen annimmt. Die Beispiele, die Robert Habeck zur Wahrnehmungsänderung nannte, sind bekannt – typisch die Don-Quichotterien im Kampf gegen die Windmühlen oder der Eiffelturm, der vom Stadtscheusal zum Stadtsymbol avancierte. Um die Debatte nicht im Ästhetischen zu verengen, schlug Habeck vier für den Disput klug gewählte, thematische „Stränge“ vor: Man müsse
1) ermöglichen, dass Bürger selbst mit Solaranlagen, Wind-Parks und ähnlichem Geld verdienen. Das sei in einer kapitalistischen Gesellschaft so.
2) die Windräder und Solarstromfelder vielleicht schöner gestalten.
3) die Selbstwirksamkeit der Menschen stärken, sie also spüren lassen, dass sie etwas zum Gelingen einer guten Sache beitragen – statt im „früher war alles besser“ zu verharren.
4) Man solle ein positives Narrativ dazu finden, dass die „Natur“ durch die Energiebauten verschönert werde – wohl wissend, dass es ohnehin nur noch eine menschengemachte „Natur“ gibt.
Der Moderator war mehrfach zur Stelle, um den Ex-Minister auf seine Redezeit hinzuweisen. Habeck winkte scheinbar genervt ab – und darin zeigte sich: Es kennzeichnen ihn sowohl Ehrgeiz als auch enormes Machtbewusstsein – und das benannte politische Talent.
Zweck und zwecklos
Mit Punkt 2) traf er aber in der Bayerischen Architektenkammer auf die „Richtigen“. Mei Liaber! Denn Fabienne Hoelzel und Werner Sobek wandten sofort ein, dass alles Gebaute ästhetisch sei. Habecks vorgetragene Trennung von Architektur und „Zweckbauten“ ist nicht haltbar, weil sie eine erledigte Diskussion des 20. Jahrhunderts aufgreift und ästhetische Aspekte des Funktionalismus – inklusive der „Leistungsform“ – ignoriert. Hat doch gerade schon Jörg Schlaich (1934-2021), Bauingenieur und Sobeks Spiritus Rector an der Universität Stuttgart, klarzustellen gewusst, dass die Baukunst unteilbar ist.iv Und Werner Sobek selbst erinnerte sich, wie einmal in einem Entwurf bei Peter von Seidlein das Auflager eines Doppel-T-Trägers auf einer runden Betonstütze zu detaillieren gewesen sei. Eine geometrisch und materialtechnisch lehrreiche Übung. Rigips drumrum? Nein. „Gott sieht alles“, habe Seidlein geantwortet. Solche fundamentalen Aspekte des Gestaltens, das alles Menschengemachte betrifft, gilt es einfach anzusprechen und zu durchdenken. Und hier wäre eine Chance gewesen, die Diskussion zurück in die von Habeck vorgeschlagenen Stränge zu lenken, was aber leider nicht gelang. Zudem stellte sich mir die Frage, wer Robert Habeck im Vorfeld zu Fragen der aktuellen Architektur-Stadt-Landschaft-Thematik beraten hatte.
Feindbilder
Die „Narrative“ rückten in den Vorgrund, etwa in dem Sinne, dass Friedrich Merz und Markus Söder und andere Reaktionäre Windräder im Bild einer „Verspargelung der Landschaft“ verteufelten – und dem etwas Positives entgegenzusetzen sei. Das stimmt sicher, Fabienne Hoelzel stimmte auch gleich zu und fügte an, dass ihre Erfahrungen als Stadtplanerin in Afrika vor allem mit einer schwierigen Beteiligungskultur verbunden sei. Zudem sprach sie das ästhetische Elend im Allgäu an, wo sie häufig Sport treibe und das Elend nichts mit Windrädern oder Solardächern zu tun habe. Auch hier bot sich eine Gelegenheit, das „Schöne“ oder „Hässliche“ der Landschaft auch ursächlich zu analysieren. Denn nirgendwo sonst in Europa manifestiert sich die aus gequälten Seelen entwickelte Naturvorstellung der Deutschen Romantik so deutlich wie hierzulande in folkloristischem Bewusstsein und in heute unzeitgemäßer Gesetzgebung im Naturschutz. Auf Letztere kam der moderierende Landschaftsplaner Sören Schöbel-Rutschmann immer wieder zurück, nicht aber auf die Wurzeln dieser ästhetischen Kuriosität in der deutschen, bürokratisierten Idee von Landschaft und Naturschönem.

Robert Habeck, Werner Sobek (Bild: Ursula Baus)
So weise ich auf den Kommentar von Gerhard Matzig, der meinte: „Es geht nicht um Design, es geht um Ästhetik. Der Diskurs ist erst am Anfang.“v
Die Energiewende aus der technizistischen Ecke in eine ästhetische zu rücken, ist nicht falsch. Dort darf sie aber nicht bleiben, sie gehört in eine gesamtgesellschaftliche Perspektive, weil sie die Lebensgrundlagen kommender Generationen betrifft. Dort ist sie noch nicht.
Retour ins fossile Zeitalter
Die gegenwärtigen Regierungsparteien werden die Energiewende nicht mit notwendiger Geschwindigkeit vorantreiben – schlimmer noch: Sie werden eine Rolle rückwärts ins fossile Zeitalter fördern. Alles, was unsere Häuser fossil warm macht, kommt – so Habeck drastisch – von Trump, den Schaichs, von Putin, die „machen sich die Taschen mit unserem Geld voll“.
Werner Sobek war etwas Frust anzumerken, kann er doch auf Jahrzehnte wissenschaftlichen und baupraktischen Engagements in diesem Bereich zurückschauen. So war es auch Jörg Schlaich ergangen: Was hatte er nicht alles gemacht, um die damals noch „erneuerbar“ genannten Stromerzeugungsmöglichkeiten ohne CO2-Emissionen zu entwickeln und sie dort zu realisieren, wo sie damals, in den 1980er Jahren, bereits höchst effizient realisierbar waren: in Afrika, in Saudi-Arabien, in Teilen Chinas. Von den damaligen deutschen Regierungen wurden diese Initiativen nicht im geringsten unterstützt. Und es hat sich damals schon gezeigt, wie eine schlecht informierte Wohlstandsgesellschaft abstumpft in dem Bestreben, zu einer besseren, friedlichen, langfristig zu gestaltenden Welt beizutragen.

Fabienne Hoelzel (Bild: Ursula Baus)
Macht ohne Partei
Die Grünen, so liest man dieser Tage, wollen sich wieder mit Umweltthemen profilieren. Gut so, und keiner könnte das so eloquent und intelligent wie Robert Habeck, dem, so darf man vermuten, eine Partei aber einen viel zu kleinen Wirkungskreis bietet. Im aktuellen Spiegel (7. Juli 2025) ist zu lesen, dass er ein »Senior Fellowship am Dänischen Institut für Internationale Studien« (Kopenhagen) werde. Auch werde Habeck laut Bundesanzeiger ‚Gastprofessuren an verschiedenen außereuropäischen Universitäten‘ wahrnehmen, des Weiteren werden ‚freiberufliche Engagements als Redner zu verschiedenen Anlässen‘ in der Mitteilung genannt“.
Wenn, wie ich denke, die Parteien nun nicht in der Lage sind, die Demokratie systemisch für eine sichere Zukunft zu modifizieren, könnte – um nicht umstürzlerische Radikalität vorzuschürzen – vorläufig das Amt des Bundespräsidenten eine gewisse Rolle spielen und der parteipolitischen, lobbyistisch korrumpierten „Macht“ der Parteien etwas gegenüberzustellen.

Robert Habeck (Bild: Ursula Baus)
Der oder die BundespräsidentIn hat überparteilich das Notwendige des gesamtgesellschaftlichen Spektrums anzusprechen. Zu Amt und Aufgaben heißt es auf der Website des Bundespräsidialamtes:
„Der Bundespräsident ist ‚lebendiges Symbol‘ des Staates. Über den Parteien stehend, wirkt er durch Ausübung seiner verfassungsrechtlichen Befugnisse, in Reden, Ansprachen, Gesprächen, durch Schirmherrschaften und andere Initiativen integrierend, moderierend und motivierend.“vi
Fabienne Hoelzel sprach von „Leadership“, die man eben auch brauche – dem Amt der BundespräsidentIn eignet keine „Leadership“ im herkömmlichen Sinne, sondern eine Macht, die auf Öffentlichkeit und Glaubwürdigkeit angewiesen ist und gesamtgesellschaftlich Wirkung zeigt.
Man darf nun sagen, dass Frank-Walter Steinmeier weder mit rhetorischem Talent gesegnet ist, noch – bislang – in der Art seiner Amtsführung bundesweite Begeisterungsstürme verursacht. Fällt uns jemand ein, der einige Jahre jünger, medial prominent und das Amt mit Intelligenz und Wissen, etwas Witz und Seriosität sowie Meinungs- und Gesprächsbereitschaft führen könnte? Und die Macht dieses Amtes dazu nutzen könnte, Grundlagen demokratischer Entwicklungen und menschlichen Daseins zu vergegenwärtigen und in allen medialen Kanälen bewusst zu machen?

Rückfahrt der Autorin: Laut Fahrplan mit einer Reisezeit von 3 Stunden; faktisch waren es 5 1/2. Böschungsbrand bei Regen, statt durchgehendem ICE: Stop auf fast halber Strecke, weil die Bahnmitarbeiter sonst länger als gesetzlich zugelassen gearbeitet hätten. (Bild: Ursula Baus)
Klimakulturkompetenz
Der beginnende Diskurs zur „Klimakulturkompetenz“ bedarf jedenfalls kraftvoller Argumente und personeller Präsenz gegenüber den Lobbyisten aus Wirtschaft und den ewig Gestrigen. Im weitesten Sinne geht es um öffentliche Intellektuelle, die es immer schwerer haben, eine gesamtgesellschaftliche Auseinandersetzung mit Lebensgrundlagen, Transformationen und vielem mehr anzustoßen und aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu analysieren – eben nicht primär den wirtschaftlichen. Bundespräsidenten wie Richard von Weizsäcker, Roman Herzog oder Joachim Gauck gaben weiland einflussreiche, bewegende Anstöße und befassten sich kraft ihrer Macht und öffentlichen Präsenz mit Impulsen für eine offene, diskursbereite Gesellschaft.
Die Macht dieses Amtes könnte inhaltlich zu angemessenem Leben erweckt werden – mit einem umfassenden, politischen Impetus, den Parteien maßgeblich in ihrer Selbstreferenzialität nicht mehr haben. Habeck meinte im erwähnten Gespräch, im Lande der Dichter und Denker sei heute das Befassen mit Philosophie ein Malus, wenn man in der Politik sei.vii Stimmt, muss aber nicht so bleiben. Es lohnt sich – die Sommerpause steht bevor – Max Weber zu lesen, der die gesinnungs- und verantwortungsethischen Maximen des Politischen in einem schmalen Büchlein differenziert hat. Einigermaßen grob vereinfacht: Ein Gesinnungsethiker stellt den Erfolg seines Handelns einer göttlichen oder sonstigen Instanz anheim. Ein Verantwortungsethiker weiß, dass er für vorhersehbare Folgen seines Handelns selbst verantwortlich ist. viii
VerantwortungsethikerInnen finden wir in der derzeitigen Politik kaum noch.
1) Nachträglich als Video 2:00 Stunden: https://byak.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=dbfe82b2-4033-4291-ab76-b30d00d0ea17
2) Robert Habeck: Die Natur der Literatur. Zur gattungstheoretischen Begründung literarischer Ästhetizität. Diss., Hamburg 2000 (https://d-nb.info/961036354/04)
3) Jüngst auch als Gast bei der Phil Cologne
5) Gerhard Matzig: Gott sieht alles. Heißes Thema in heißen Tagen. In: Süddeutsche Zeitung, Nr. 149, 2. Juli 2025
7) siehe Anm. 3
8) Max Weber: Politik als Beruf. 1919, Ausgabe mit einem Nachwort von Rolf Dahrendorf, Reclam 2008

