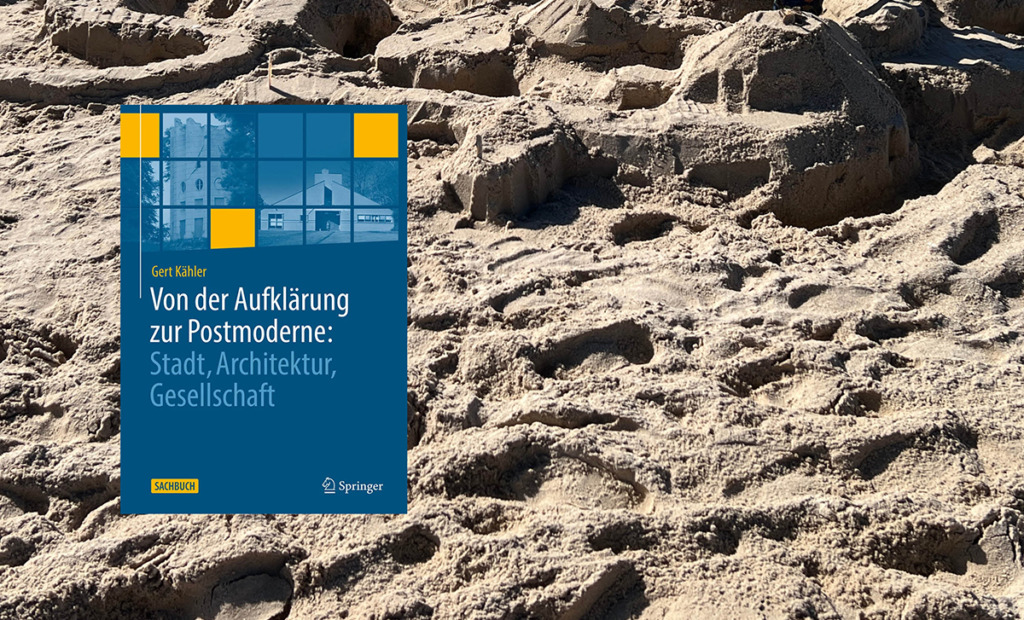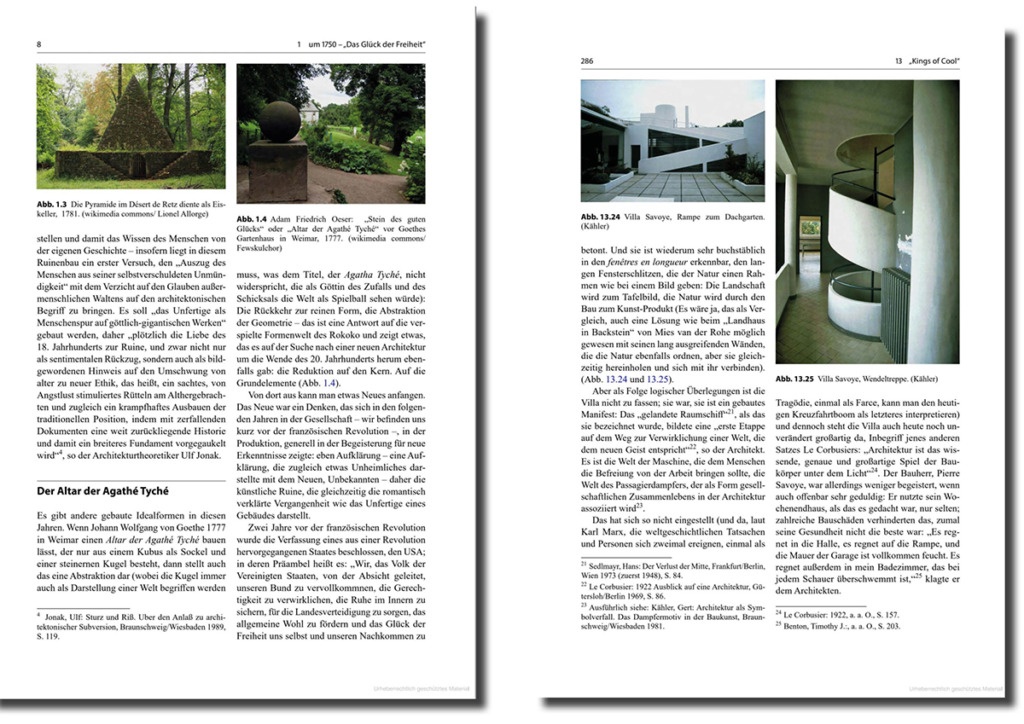Es ist ein Buch zu einer (noch nicht abgeschlossenen) Architektur-Epoche, über die es bereits zahlreiche Publikationen gibt. Dennoch ist diese subjektiv gefärbte, gut lesbare Auseinandersetzung nicht überflüssig: Es ist unerlässlich, dass wir als an der Architektur Interessierte jede Chance nutzen, unser allmählich verblassendes Halbwissen aufzufrischen.
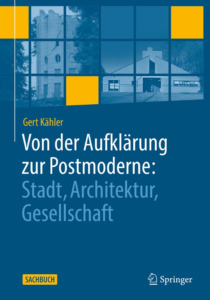
Gert Kähler: Von der Aufklärung zur Postmoderne. Stadt, Architektur, Gesellschaft. 644 Seiten, 567 Abbildungen, Format 18,3 x 26 cm. Springer 2025, ISBN 978-3-658-46544-5 54,99€
Ein solider blauer Band, stabil gebunden, erinnert an den ARAL-Autoatlas. Zur Warnung steht auf dem Titel „Sachbuch“.
Es beginnt mit einer hübschen „Vorbemerkung“. Darin kokettiert der Autor ein wenig mit seinem Alter und teilt uns mit, warum er sich mit 83 wieder – besser: immer noch – an die Arbeit gemacht hat: weil „heutige Architekturstudenten und Architekten zu wenig von dem Thema wissen“. Howgh, ich habe gesprochen! Dem könnte man entgegenhalten, dass die letzten 250 Jahre Architekturgeschichte regelmäßig neu inventarisiert und kanonisiert wurden und in einem halbwegs sortierten Architekturbüro irgendeine Schwarte von Benevolo, Pehnt, Durth/Sigel, Major, Pevsner, Klotz, Jencks et al. vorhanden sein wird. Andererseits muss man zugeben, dass man das Gebaute aus dieser langen Neuzeit nur noch fragmentarisch erinnert. Es bietet sich also eine Gelegenheit, sein bruchstückhaftes Wissen mit der persönlichen Wahrnehmung und Wertung des Autors zu konterkarieren.
Struktur und Methode
Die über 600 Seiten sind zunächst in drei große Abschnitte gegliedert: vor 1900, bis zum zweiten Weltkrieg und schließlich die Ankunft in der Gegenwart. Die dann folgenden einzelnen Kapitel stehen zwar jeweils unter einem Thema, aber man wird beim Lesen von keiner aufzählenden Chronologie gelangweilt, sondern lässt sich gerne mitnehmen zu den von Kähler ausgewählten Ereignissen und Querverbindungen – obwohl auch andere Indizien denkbar wären. Aber warum nicht mal eine Springprozession von Corbu über Mies, Aalto, Kahn und Scarpa zu Schattner!
Kähler analysiert die Orte, zerlegt, wo es nötig ist, ein Bauwerk in seine Konstruktion, vergisst aber nie den Untertitel seiner Arbeit: Stadt, Architektur, Gesellschaft. Fragt also zu Recht, ob die akademische Auseinandersetzung über Stilfragen angesichts der gesellschaftlichen Nöte und politischen Krisen überhaupt noch einen Stellenwert besitzt. Anders lässt sich gerade die Architektur des NS-Staates kaum behandeln, spielte sie doch „eine entscheidende Rolle in der Indoktrinierung der Menschen“. Diese Balance zwischen Baugeschehen und gesellschaftlichem Hintergrund bleibt bis zur letzten Seite erhalten, ohne dass die Ausführungen in einer belehrenden Exegese gipfelten. Dagegen helfen sporadisch eingestreute Ironie oder eine saloppe Bemerkung wie: dass nach dem ersten Weltkrieg die deutschen Revolutionäre „einfach keinen Bock mehr zum Kämpfen“ hatten. Spätestens jetzt bedauert man, dass man nie eine Vorlesung bei Professor Kähler erleben durfte. Und je weiter der Autor im Heute ankommt, um so architekturkritischer wird seine Auseinandersetzung. Er nimmt sich Zeit, um Begriffe (High-Tech) beiläufig eingehend zu erläutern, oder hält sich mit herausragenden Bauwerken (Staatsgalerie Stuttgart) auf, weil sie stellvertretend für eine Entwicklung stehen. Dabei schafft er es, seine Tour d’Horizon wie selbstverständlich zu absolvieren. Manchmal ist es eine Typologie, ein Ort, ein Name, ein Material oder sogar ein Gegensatz, der zwischen den sachlichen Ereignissen eine assoziative Verbindung herstellt. So kommen wir nahtlos von Erskine zu Bofill. Kähler kann erzählen.
Zum Erzählen
Bei so einem umfangreichen Werk kann es leider nicht ausbleiben, dass auch Wiederholungen unterlaufen, bisweilen im selben Abschnitt. Das ist allerdings nur eine lässliche Sünde, denn außer dem Rezensenten werden nur Wenige das Buch an einem Stück lesen. Dann hilft es sogar, wenn man das Gefühl gewinnt, dass man sich im Text schon etwas auskennt.
Was mir als pingeligem Kollegen allerdings bitterer aufstößt, ist die Beobachtung, etwa alle fünf Seiten auf einen, sagen wir: Schreibfehler zu treffen. Auch nahe beieinanderstehende Wort- und Begriffsdoppelungen hätte man vermeiden können, ebenso, dass sich dieselben Hilfsverben begegnen, wenn ein Hauptsatz an einen Nebensatz anschließt. Das liest sich stotterig. Man darf das aber keinesfalls dem Autor anlasten. Wenn man sich intensiv um den Inhalt seines Textes kümmert, kennt man ganze Passagen auswendig und sieht sie beim Korrekturlesen nicht mehr. Das wäre die Aufgabe eines Lektorats gewesen.
Lesen und Schauen
Betrachtet man die gesamte Buchaufmachung, hat man das Gefühl, eine aussterbende Kulturleistung in Händen zu halten. Die selbst „geknipsten“ (sagte man früher) Abbildungen, die der Autor beigesteuert hat, beweisen vor allem, dass er die Gebäude besucht hat. Fotografische Brillanz ist etwas anderes. Die Seitengestaltung sieht aus, als hätten ungelernte Hilfskräfte Textspalten und Abbildungen irgendwie zusammengeschoben. Halten zu Gnaden: Die Zielgruppe sind Architekten, die haben ein Gespür für Ordnung, Balance, Symmetrie, Weißräume! Ja, wir wissen es: Mit etwas bibliophiler Zuwendung hätte das Buch den doppelten Preis. (Noch etwas günstiger kann man es als eBook bekommen, sogar kapitelweise.)
Verlage sind wohl auf dem besten Weg, künftig nur noch als Informationsagenturen online Beiträge anzubieten. Lesbares für die User von YouTube, Netflix, Facebook und Tiktok! Aber Rettung naht. Ende August berichtete die Süddeutsche Zeitung, dass der Börsenverein eine Trendwende beobachtet. „Besondere Bücher“ erfreuen sich inzwischen guter Absatzchancen. Zu ihnen gehören Lesebändchen, Farbschnitt, Stanzungen, UV-Lack in Lippenstift-Optik und Pfefferminzgeschmack. Da ist was für die lesefaulen Kids! Also auch hier: Von der Aufklärung zur Postmoderne.