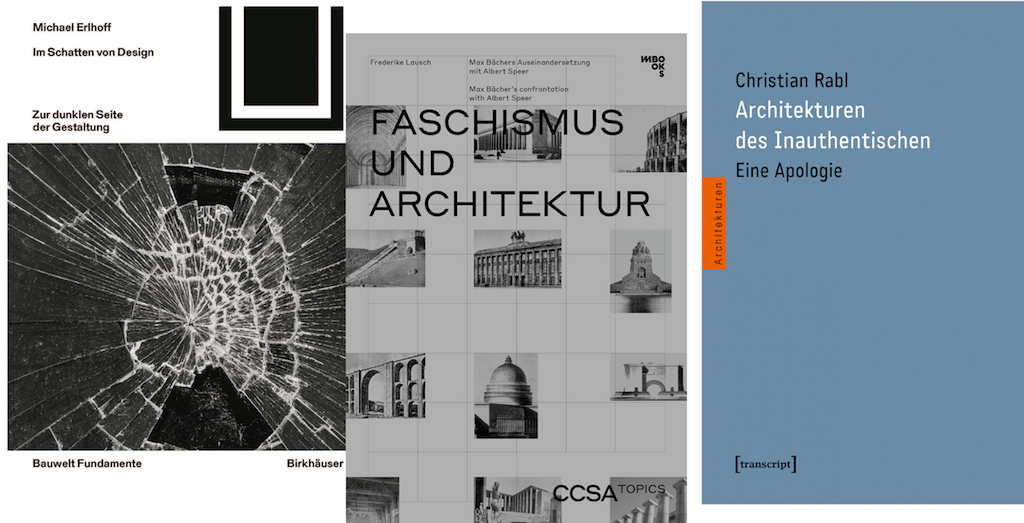Hell, klar, richtig, gut – so hätte man Architektur, Planung und Design gerne. Aber so einfach ist das nicht. Gestaltung ist Teil von Machtausübung und Voraussetzung für sie. Sie ist aber darin erkenntnis- und aufschlussreich, gerade weil sie sich nicht von Politik trennen lässt. Und die Kritik hilft, Möglichkeiten zu erkennen, auf die eine naive Idealisierung den Blick verstellt. Drei Bücher loten Tiefen und Untiefen aus.
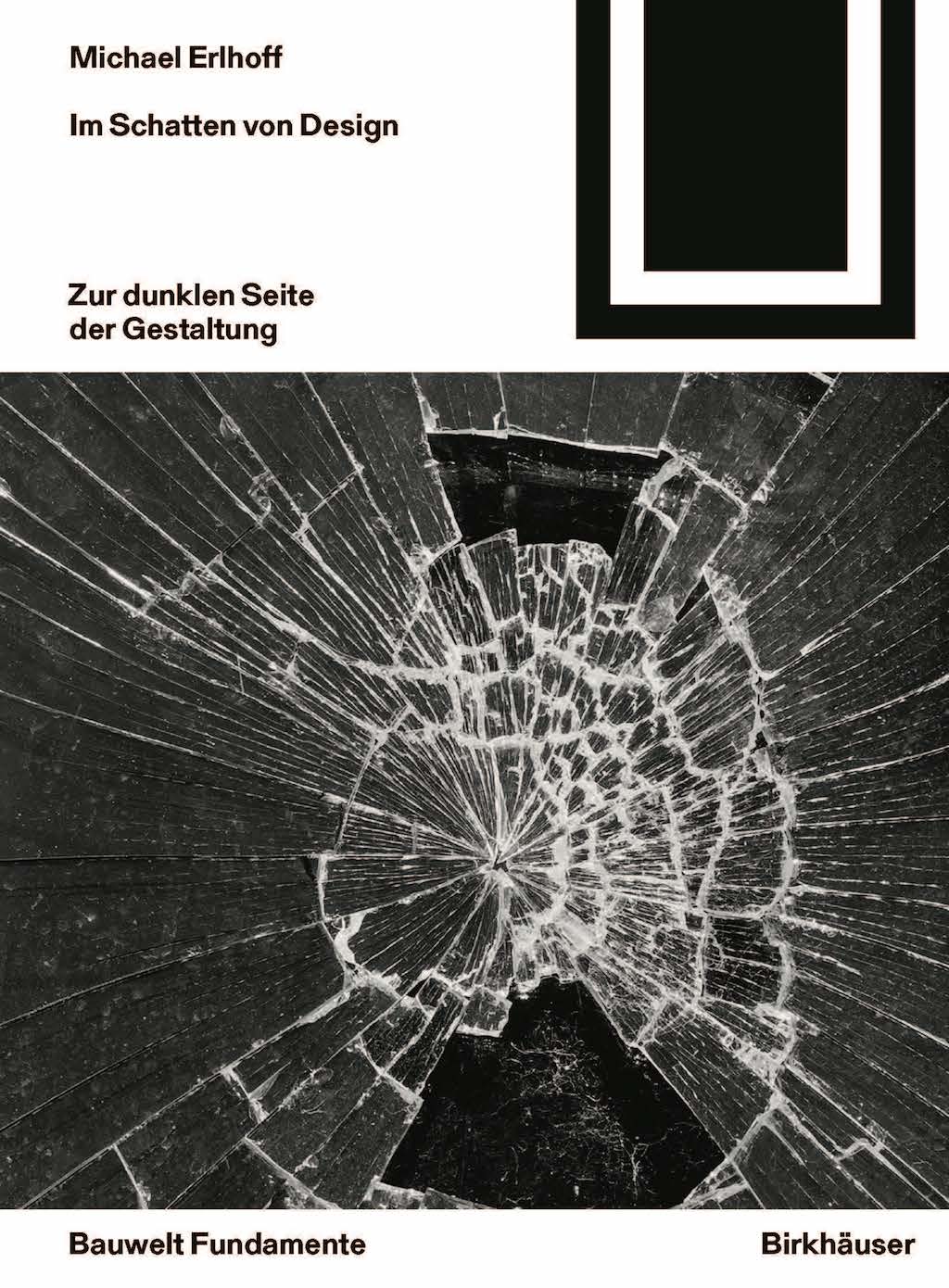
Michael Erlhoff: Im Schatten von Design. Zur dunklen Seite der Gestaltung. 156 Seiten, 14 x 19 cm, 29,95 Euro
Birkhäuser, Basel, 2021
Design brauche Erkenntnis aus Kritik und Selbstreflexion, um „der marginalen und unterwürfigen Existenz“ zu entkommen, um nicht „bloß banale Märkte, autoritäre Strukturen und üble Aktivitäten zu unterstützen“, so der kürzlich verstorbene Designtheoretiker Michael Erlhoff. In seinem letzten Buch widmet er sich der dunklen Seite von Gestaltung: den Bauhaus-Desingern und Architekten, die sich dem Dritten Reich angedient haben, den Gestaltern von Waffen und elektrischen Stühlen, den Designern von Klängen und Gerüchen, die aufs Unterbewusste zielen und so den Konsum nur noch umso ungehemmter ankurbeln. Erlhoff schreibt über die Floskeln, die die Reflexion behindern, statt sie zu befördern (etwa die von den Narrativen), von den bigotten Diskussionen (etwa die über eine den rauchenden Jackson Pollok zeigende Briefmarke), und er beklagt den Mangel an Auseinandersetzungen darüber, in welche kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Prozesse Design eingebunden ist.
Das alles wird eloquent, kenntnisreich und gut lesbar in Texten gefasst, deren Länge es erlaubt, sich den schweren Inhalt in verdaulichen Portionen anzueignen. Es ist wichtig, immer auch zu bedenken, dass die gute Gestaltung den schlechten Zielen dienen kann. Und doch bleibt bei aller Dramatik, mit der Erlhoff die Widersprüchlichkeit von Design darlegt, ein Unbehagen: Weil das Design immer als eine Art Aufsatz behandelt wird, das dann einsetzt, wenn die grundsätzlichen Entscheidungen – dass eine Waffe gestaltet, ein elektrischer Stuhl entworfen werden muss – bereits gefallen sind. Das scheint mir dann doch zu kurz zu greifen, damit wird das eigentlich Beängstigende portioniert, so als könne man es sich leisten, auf das eine zu verzichten, um das andere als hässlich und abgründig, als böse zu demaskieren. Dabei ist das Design schon Teil dessen, was überhaupt gemacht und damit eben auch gedacht werden kann. Es ist deswegen noch auf eine viel intensivere Weise mit der Ambivalenz menschlicher Kreativität und Existenz verbunden, ja, ist ihr untrennbarer Teil.
Unter dem Titel Nachrufe sind die letzten fünf Texte zusammengefasst. Sie verbreiten eine Art Endstimmung des Designs als einer skrupellosen Disziplin, in der nicht von den Beschädigungen gesprochen wird, an der sie partizipiert. Die Rede ist von den endgültigen Lösungen, die sich als Illusionen gut verkaufen, dabei aber Berge von Müll produzieren, weil das Ende nicht als Designaufgabe verstanden wird. Da ist dann auf einmal auch wieder Hoffnung, vielleicht sogar etwas viel Hoffnung: Wenn man auf die Illusion der endgültigen Lösung verzichtete, sich um das Ende der Architektur, ihren Abriss sorgte, könnte es schließlich doch besser werden. Also doch? Der Katarrhakt der drastischen Beschreibung mag es befördern, dass Designer*innen ihr eigenes Tun hinterfragen und die Instrumentalisierung ihres Tuns nicht als unabänderliches Schicksal hinnehmen. Das wäre schon viel. Aber Menschen, die Waffen gestalten, wird es dennoch immer geben.
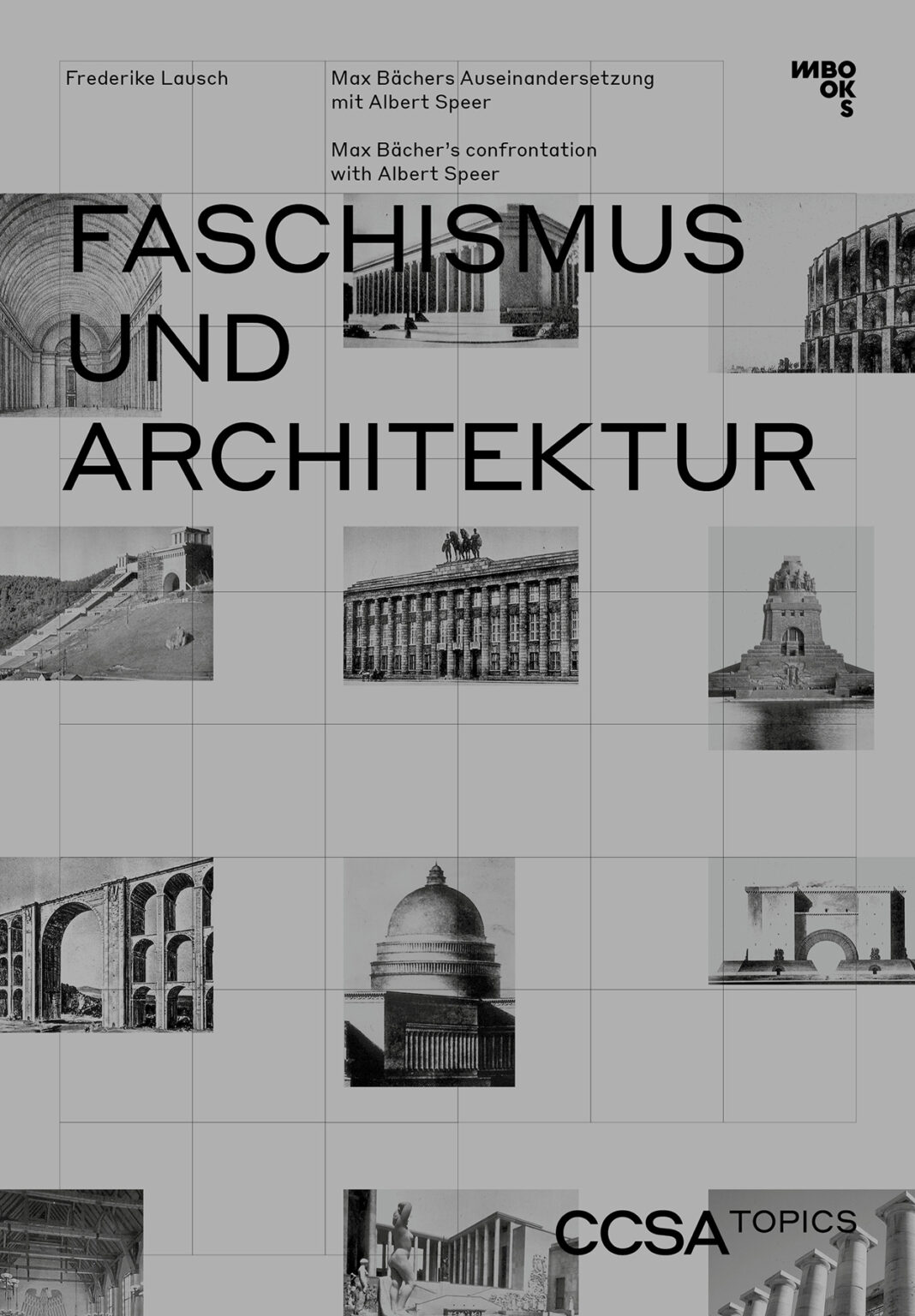
Frederike Lausch: Faschismus und Architektur. Max Bächers Auseinandersetzung mit Albert Speer. Herausgegeben von der Wüstenrot Stiftung und dem CCSA. 276 Seiten, 190 s/w_abbildungen, 16 x 23 cm, deutsch/englisch, 15 Euro
M Books, Weimar, 2021
Am 17. Februar 1973 trifft Max Bächer Albert Speer. Auf der einen Seite der 1925 geborene Architekt, die in großem Maße als Preisrichter einflussreiche Persönlichkeit der Nachkriegsarchitektur, auf der anderen Seite der 20 Jahre Ältere, auch er Architekt, der rasch im Dritten Reich Karriere machte und zum Generalbauinspektor der Reichshauptstadt aufstieg, direkt Hitler unterstand und schließlich auch Rüstungsminister geworden war. Bächer hatte sich von dem Treffen Erkenntnisse darüber erhofft, wie Speer als Architekt dachte, wie er Verantwortung als Architekt verstanden hatte – im Unterschied zu der des Rüstungsministers. Das Gespräch verlief für Bächer enttäuschend. Speer zeigte sich wenig auskunftsfreudig, vor allem konnte er die Trennung zwischen Architekt und Rüstungsminister, zwischen Politik und Baukunst, die sich Bächer zurecht gelegt hatte, um einen Zugang zur Architektur des Nationalsozialismus zu finden, offensichtlich nicht nachvollziehen. Den Versuch, Verständnis für den Architekten Speer aufzubringen, gab Bächer dann bald auf – die Veröffentlichung über Speers Architektur von 1978 kritisierte er öffentlich und heftig als eine Festschrift, „die herauszugeben dem Dritten Reich nicht mehr vergönnt war.“ Auch das Bemühen um eine vom Politischen getrennte Sicht auf die Architektur Speers gab er auf: In einem offenen Brief an Speer schrieb er 1979, dass man den Reichsminister nicht vom Architekten trennen könne, auch die Kriegszerstörungen seien Speers Architektur, nur mit anderen Mitteln.
Das Buch ist auch die Geschichte des Scheiterns, das uns die Autorin knapp, aber präzise nachvollziehen lässt. Des Scheiterns Bächers, bei allem Skrupel vor den Verbrechen der Nationalsozialisten den weißen Fleck in der Architekturdiskussion zu füllen, einordnen zu können, was die Architektur des Faschismus ausgemacht hat. Vorträge hatte er darüber gehalten, aber deren Manuspripte nie ausgearbeitet, nie so eine Ordnung in seine Gedanken über die Architektur der Zeit, die er als Jugendlicher und junger Erwachsener erlebt hat, gebracht, dass sie veröffentlichungsreif gewesen wären, dass sie gar ein Buch ergeben hätten.
„Unentwegt widerspricht er sich und verändert seinen Standpunkt darüber, ob und wie Architektur und Politik getrennt voneinander betrachtet werden können“, so Frederike Lausch in ihrem Fazit. Bächer appelliere an die Verantwortung der Architekturschaffenden und scheute sich doch, „vor einer eindeutigen Positionierung, einer konkreten Benennung eines ,gegenwärtigen Faschismus‘ und daraus abzuleitenden spezifischen Forderungen an die zukünftigen Generationen.“ Dieses mühevolle Scheitern wird sehr anschaulich und ansehnlich im Buch ausgebreitet, in Bild- und Schriftdokumenten, Briefen, Notizen, Aufzeichnungen. Das Scheitern erzählt von den Schwierigkeiten, zwischen dem Verstehen und dem Urteilen einen Weg zu finden, der eine künstlerische Leistung noch dort erkennen will, wo der Kontext ein mörderischer war. So sehr wir wiederum Verständnis für Bächer aufbringen mögen – immerhin erforschte er die Zeit seiner Jugend – so aktuell ist seine Widersprüchlichkeit und Unsicherheit für den heutigen Umgang mit rechten Tendenzen und mit der Frage, wo Architektur und Politik voneinander getrennt werden können. Und wo nicht.
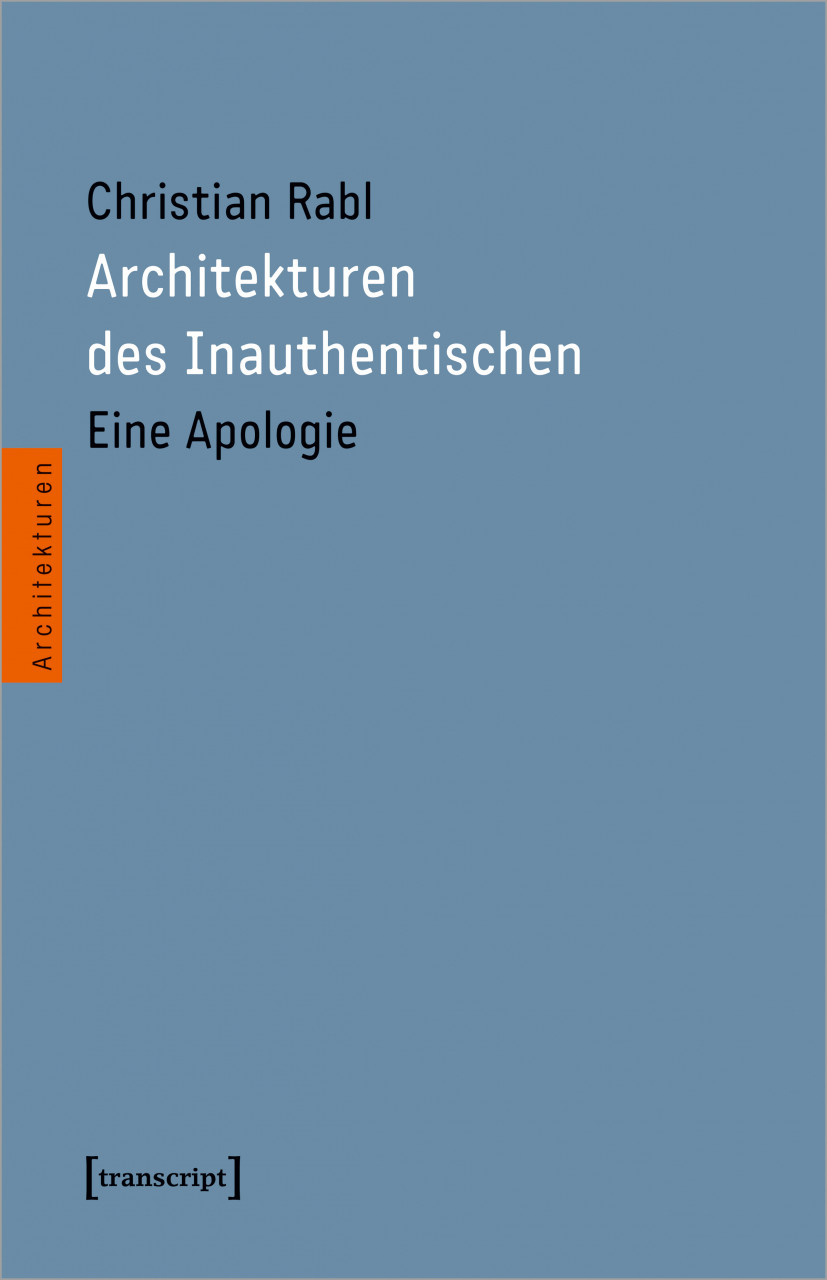
Christian Rabl: Architekturen des Inauthentischen. Eine Apologie. 560 Seiten, 15,5 x 24 cm, 55 Euro
Transcript Verlag, Bielefeld, 2020
Sigfried Giedion sprach vom Schleim, den man von den Bauten des 19. Jahrhunderts kratzen müsse. Bis heute hat sich – aller Modernekritik zum Trotz – das prägend erhalten, was Rabl in seinem Buch über Architekturen des Inauthentischen als „architektonische Authentizitätsnarrative der Funktions- und Materialgerechtigkeit“ ausmacht: eine von Ruskin über Gropius bis in die Gegenwart noch der Neokonservativen und Neotraditionalisten reichende Sehnsucht nach einem vermeintlich Echten oder Wahren. Sie wird in Stellung gebracht gegen den Historismus ebenso wie gegen die, wie es Winfried Nerdinger nannte, „unerträgliche Phraseologie des Bauhauses“, gegen Bauwirtschaftsfunktionalsmus und einen um seiner selbst Willen betriebenen Fortschrittsglauben. Und natürlich gegen die der Vermarktung dienenden Inszenierungen von Innenstädten, Factory Outlets, Vergnügungsparks. Authentizität wird gegen die Verführungen der Konsumwelt und als individuelles Selbstverwirklichungideal bemüht. Dass sie gerade darin zum Produkt wird, sich wieder herrlich vermarkten lässt, ist nicht Thema dieses Buchs, was schon an der bisweilen etwas arg geschraubten Sprache deutlich wird: Die einfachen Weisheiten sind nicht das Anliegen Rabls. Sondern die Ambivalenzen, die sich den einfachen Weisheiten entgegenstellen. Er beschreibt das Inauthentische, das Kritisierte und Verschmähte als eine Möglichkeit, intellektuelles Kapital zu schlagen – zum einen, indem die Unterstellungen, mit denen das Inauthentische konfrontiert ist, gegen das vermeintlich Wahre gewendet werden. Zum anderen, indem es vorurteilsfrei untersucht erst differenziert betrachtet werden kann.
Damit wird das für so stabil und verlässlich empfundene Verhältnis zwischen dem Guten und dem Schlechten nicht einfach herumgedreht: Rabl macht das „Gute“ nicht zum „Schlechten“ – es geht hier vor allem um eine öffnende, ja befreiende Relativierung. Was für gut gehalten wird, weil es angeblich authentischer ist, ist auch nur eine Möglichkeit, die Möglichkeit einer welterschließenden Neubeschreibung, wie mit Bezug auf Richard Rorty gleich im ersten Absatz der Vorbemerkung zu lesen ist. Es ist immer ein Kluft auszumachen zwischen dem, was die Gestaltung behauptet zu sein und dem, was in sie hineinprojiziert wird, was sich gerade auch im Gebrauch der Dinge und Häuser zeigt – und das hebt sie darüber hinaus, nur Medium einer Verwirklichung des guten Lebens zu sein. Entfaltet wird dies auf weit über 500 Seiten sowohl an Begriffen des Authentischen (künstlerischer Autorenschaft, Materialwahrheit etwa) und an Beispielen des Inauthentischen wie des Historismus, der Themenarchitektur aber auch der Rekonstruktionsprojekte einerseits und sechs „Hauptstätten des Inauthentischen“ andererseits: Budapest, Tiflis, Baku, Wiesbaden, Atlantic City und Doha. Diese Auswahl mag man kritisieren können, aber darauf kommt es vielleicht nicht an – denn die Entdeckungsreisen, zu denen uns Rabl einlädt (ohne ein einziges Bild), sind eher Übungen, um selbst eigene Entdeckungen zu machen, eigene Erfahrungen, die hier nur ein wenig zu sehr in einen architekturtheroetischen Duktus gekleidet werden, der den Zugang zu den Gedanken des Autors hin und wieder doch recht mühevoll macht.