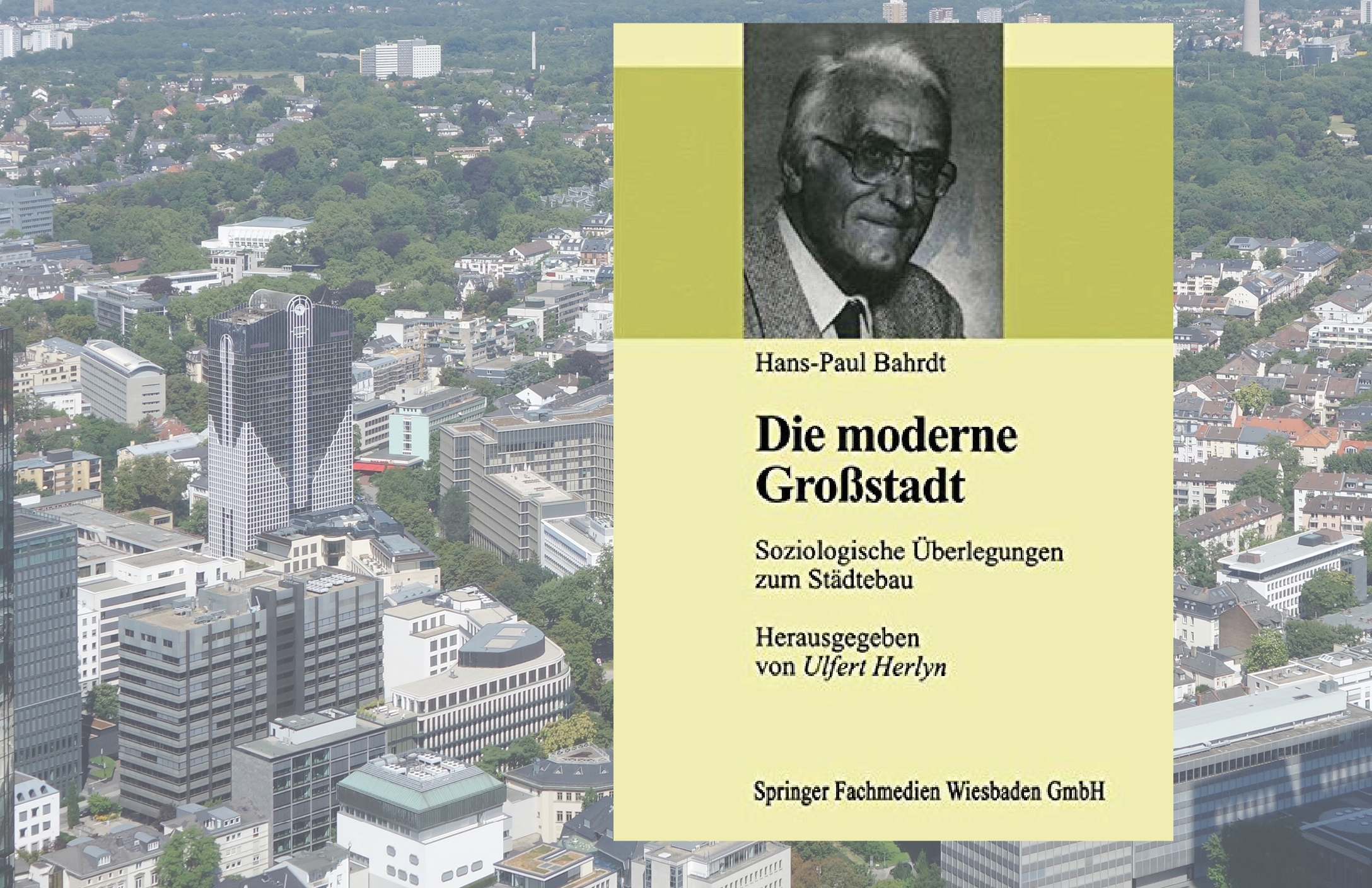Wiedergelesen: Hans-Paul Bahrdt: Die moderne Großstadt 1961/69
Seine These, dass die Polarität von öffentlich und privat die Stadt konstituiert, ist Gemeingut unter Planern. Doch so wie diese Polarität heute verstanden wird, muss man daran zweifeln, ob alle, die sich auf Bahrdt berufen, sein Buch auch gelesen haben. Es hält so manche Überraschungen bereit. Das gilt besonders für diese Tage.
Es gehört zu den scheinbaren Paradoxien der aktuellen Lage, dass der Rückzug ins Private zur höchst öffentlichen Angelegenheit wird. Soziale Nähe drückt man dadurch aus, dass man einander körperlich fern bleibt. Das ist aber lange nicht so paradox, wie es scheint. Die Solidarität, auf der unser Zusammenleben aufbaut, ist keine der Zuneigung. Zum Glück. Sie basiert auf Rechten, die man sich nicht verdient, für die man keine Leistung erbringen sollte, für die man nicht geliebt werden muss. Carolin Emcke hatte in ihrer Rede zur Verleihung des Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2016 gesagt: „Verschiedenheit ist kein Grund für Ausgrenzung. Ähnlichkeit keine Voraussetzung für Grundrechte. Das ist großartig, denn es bedeutet, dass wir uns nicht mögen müssen. Wir müssen einander nicht einmal verstehen in unseren Vorstellungen vom guten Leben. Wir können einander merkwürdig, sonderbar, altmodisch, neumodisch, spießig oder schrill finden.“ (1) Ob wir einander die gleichen Rechte zugestehen, bleibt davon unberührt. Solidarität ist also auch schon vor Corona nicht abhängig von Zuneigung, von sozialer Nähe gewesen – und deswegen ist es auch keine Paradoxie, wenn wir nun voneinander Abstand halten, um einander zu schützen, denn die, von denen wir Abstand halten, sind ja möglicherweise nicht die, denen unser Verhalten zugute kommt.

Die Bildbeiträge zu diesem Text sind Momentaufnahmen des öffentlichen Raums, die vor der Corona-Epedemie gemacht wurden. Die aktuelle Entwicklung verstärkt lediglich, was bereits angelegt war. (Alle Bilder: Christian Holl)
Die Dualität von öffentlich und privat ist auf eine ähnliche Weise ineinander verschränkt. Es gehört zum guten Ton in den Reden über Städtebau, darauf zu bestehen, dass die Trennung von öffentlich und privat eine Qualität ist. Fast schon reflexhaft wird damit ein Bild des Raumes und des Städtebaus verknüpft, der auf der formalen Behandlung der Trennung basiert und in den meisten Fällen auf eine wie auch immer variierte Blockrandbebauung hinausläuft. Gedacht wird diese Trennung vom öffentlichen Raum her: von dessen eindeutiger Fassung, von der Idee eines Behälters, der das öffentliche Leben aufzunehmen hätte. Die Häuser mit den Wohnungen formulieren durch die Wände eine Grenze, bis zu der das Öffentliche reicht. Alles, was dadurch vom Öffentlichen abgetrennt wird, ist dann privat. Weiterhin wird in der Regel der Bereich, der zugänglich, aber visuell oder real durch Hindernisse den Zugang begrenzt, als „halböffentlich“ bezeichnet. Im kürzlich hier vorgestellten Buch „Vokabular des Zwischenraums“ wurde anhand einiger Beispiel gezeigt, dass diese vereinfachte Bild problematisch ist, wenn es die Grenze nicht selbst als einen Raum versteht, in dem der Austausch zwischen innen und außen, dem Fremden und dem Vertrauten, dem Öffentlichen und dem Privaten organisiert werden kann – und die Qualität macht sich nicht daran fest, dass es diese Grenze gibt, sondern daran, wie darauf eingewirkt werden kann, wie das Öffentliche dosiert in das Private hineinwirken kann – durch Gärten, Loggien, Balkone, Stege, ja selbst noch durch die Organisation der Wohnungsgrundrisse.
Ausgewogene Polarität
Doch öffentlich und privat sind nicht nur auf diese reale und physische Weise ineinander verwoben. Dass die Grenzen zwischen beiden Kategorieren sich schon lange verflüssigt haben, ist eine Binse. Die Verschränkung des Öffentlichen und des Privaten ist auch auf einer ganz anderen Ebene zu suchen und zu beachten. Dazu ist es sinnvoll, wieder das Buch in die Hand zu nehmen, das maßgeblich die Grundlagen für Rhetorik der Dualität aus Öffentlich und Privat gelegt hat: „Die moderne Großstadt“ von Hans-Paul Bahrdt, das 1961 zum ersten Mal und 1969 in einer überarbeiteten Fassung erschienen ist. (2) Bahrdt ist Soziologe und er vertrat in dem Buch die These: „Öffentlichkeit und Privatheit seien in ihrer Spannung und gegenseitigen Bedingtheit Grundprinzipien des städtischen sozialen Lebens.“ (S. 30)
 Dass Bahrdt unter Öffentlichkeit sehr viel mehr verstand als lediglich ein ungeteiltes Aufenthaltsrecht, macht er bereits in der Einleitung deutlich, in der er scharf das Private im soziologischen und kulturellen Sinne von dem Privaten des Besitzes trennt. Denn Privatbesitz im Zuge der kapitalistischen Entwicklung versteht er als Ausdehnung der Machtsphäre. Diese „verursacht aber eine Verkleinerung der konkreten Privatsphäre anderer Menschen: Ihr Erwerbsbereich wird entprivatisiert.“ (S. 39) Diese Ausdehnung privater Verfügungsgewalt über Sachen kann eine „kapitalisitsche Schwelle“ überschreiten, was „die ausgewogene Polarität von Öffentlichkeit und Privatheit bedrohen kann, in dem sie Lebensbereiche partiell entprivatisiert, ihre Überführung in den Aggregatzustand der Öffentlichkeit gleichzeitig verhindert.“ (S. 41) Das kann auf die Produktion, das Erwerbsleben bezogen werden – aber eben auch auf Einkaufszentren, Großveranstaltungen, Wegerechte: Überall dort schränkt ein zu starker privatrechtlicher Einfluss die öffentliche Sphäre ein. Bezeichnend ist aber, dass Bahrdt den Eingriff des ungleichgewichtigen Privateigentums als „Entprivatisierung“ versteht und deswegen forderte, dass das Privateigentum an Produktionsmitteln, Boden und Gebäuden kein Tabu sein dürfe. (S. 49) Schon hier wird deutlich, dass die Spannung zwischen dem Öffentlichen und dem Privaten auch und wesentlich vom Privaten her gedacht wird, das für eine Qualität des Öffentlichen genauso entscheidend ist wie die des Öffentlichen für das Private. Hierbei mögen die Erfahrungen des NS-Regimes, das die Privatheit fast vollständig zersetzt hatte, für Bahrdts Argumentation eine wichtige Rolle gespielt haben, ohne dass sie explizit so darauf bezogen wurde. Nicht ohne Grund: Für Bahrdt sind eben auch weitaus weniger weitreichende Eingriffe in die Privatsphäre geeignet, die „ausgewogene Polarität“ zu bedrohen. Und deswegen ist es wichtiger denn je, auch das Private in den Blick zu nehmen und zu schützen. Oder um es etwas zuzuspitzen: Wenn – derzeit – die Straßen leer sind, ist das keine Bedrohung für das öffentliche Leben. Dass die Versuchung groß ist, in die Grundrechte einzugreifen und durch öffentlichkeitswirksame Vorschläge zu Überwachung und Kontrolle diese Eingriffe vorzubereiten, das ist aber sehr wohl eine Gefahr. Dass wir gerade jetzt darüber diskutieren müssen, wieviel uns die Grundrechte wert sind, hatte Sascha Lobo kürzlich betont. Wenn solche Debatten nicht geführt werden dürfen, ist das eine Gefahr. (3)
Dass Bahrdt unter Öffentlichkeit sehr viel mehr verstand als lediglich ein ungeteiltes Aufenthaltsrecht, macht er bereits in der Einleitung deutlich, in der er scharf das Private im soziologischen und kulturellen Sinne von dem Privaten des Besitzes trennt. Denn Privatbesitz im Zuge der kapitalistischen Entwicklung versteht er als Ausdehnung der Machtsphäre. Diese „verursacht aber eine Verkleinerung der konkreten Privatsphäre anderer Menschen: Ihr Erwerbsbereich wird entprivatisiert.“ (S. 39) Diese Ausdehnung privater Verfügungsgewalt über Sachen kann eine „kapitalisitsche Schwelle“ überschreiten, was „die ausgewogene Polarität von Öffentlichkeit und Privatheit bedrohen kann, in dem sie Lebensbereiche partiell entprivatisiert, ihre Überführung in den Aggregatzustand der Öffentlichkeit gleichzeitig verhindert.“ (S. 41) Das kann auf die Produktion, das Erwerbsleben bezogen werden – aber eben auch auf Einkaufszentren, Großveranstaltungen, Wegerechte: Überall dort schränkt ein zu starker privatrechtlicher Einfluss die öffentliche Sphäre ein. Bezeichnend ist aber, dass Bahrdt den Eingriff des ungleichgewichtigen Privateigentums als „Entprivatisierung“ versteht und deswegen forderte, dass das Privateigentum an Produktionsmitteln, Boden und Gebäuden kein Tabu sein dürfe. (S. 49) Schon hier wird deutlich, dass die Spannung zwischen dem Öffentlichen und dem Privaten auch und wesentlich vom Privaten her gedacht wird, das für eine Qualität des Öffentlichen genauso entscheidend ist wie die des Öffentlichen für das Private. Hierbei mögen die Erfahrungen des NS-Regimes, das die Privatheit fast vollständig zersetzt hatte, für Bahrdts Argumentation eine wichtige Rolle gespielt haben, ohne dass sie explizit so darauf bezogen wurde. Nicht ohne Grund: Für Bahrdt sind eben auch weitaus weniger weitreichende Eingriffe in die Privatsphäre geeignet, die „ausgewogene Polarität“ zu bedrohen. Und deswegen ist es wichtiger denn je, auch das Private in den Blick zu nehmen und zu schützen. Oder um es etwas zuzuspitzen: Wenn – derzeit – die Straßen leer sind, ist das keine Bedrohung für das öffentliche Leben. Dass die Versuchung groß ist, in die Grundrechte einzugreifen und durch öffentlichkeitswirksame Vorschläge zu Überwachung und Kontrolle diese Eingriffe vorzubereiten, das ist aber sehr wohl eine Gefahr. Dass wir gerade jetzt darüber diskutieren müssen, wieviel uns die Grundrechte wert sind, hatte Sascha Lobo kürzlich betont. Wenn solche Debatten nicht geführt werden dürfen, ist das eine Gefahr. (3)
Öffentlichkeit heißt Transparenz
 Worin besteht nun die Öffentlichkeit? Es sei, so Bahrdt, das, was alle angehe, wobei er sehr genau wusste, dass diese Beschreibung beinhaltet, zu klären, was denn nun wirklich alle angeht. Das werde in verschiedenen geschichtlichen Perioden und von gesellschaftlichen Gruppen unterschiedlich beantwortet. (S. 37) Das heißt, es ist eine Aushandlungssache: Es muss immer wieder neu bestimmt werden. (4)
Worin besteht nun die Öffentlichkeit? Es sei, so Bahrdt, das, was alle angehe, wobei er sehr genau wusste, dass diese Beschreibung beinhaltet, zu klären, was denn nun wirklich alle angeht. Das werde in verschiedenen geschichtlichen Perioden und von gesellschaftlichen Gruppen unterschiedlich beantwortet. (S. 37) Das heißt, es ist eine Aushandlungssache: Es muss immer wieder neu bestimmt werden. (4)
Bahrdt leitet Öffentlichkeit mit Bezug auf Max Weber vom Markt ab – er sei das Kennzeichen der Stadt und die früheste Form der Öffentlichkeit, weil sich daraus ein soziales Verhalten ableite, nämlich: „eine partielle Beliebigkeit der Kontaktaufnahme all derer, die als Käufer oder Verkäufer auf dem Markt auftreten.“ (S. 83) Bahrdt charakterisiert dies als unvollständige Integration, einer seiner zentralen Schlüsselbegriffe für Öffentlichkeit: „…eine Offenheit der sozialen Intentionalität der einzelnen, deren Willkür es überlassen bleibt, mit wem, auf welche Weise und wie lange sie Kontakt aufnehmen, um zu handeln.“ (S. 86) Daraus ergibt sich ein stilisiertes Verhalten, das dem Unbekannten unmittelbar lesbare Signale sendet, damit dieser die Intention des Unbekannten erkennen kann – und gleichzeitig muss die Distanz gewahrt bleiben, um „Persönliches, das für die Offenheit sozialer Kontakte zu empfindlich ist, abzudecken und zu privatisieren.“ (S. 89)
In Bezug auf das Politische formuliert Bahrdt, dass es vor allem transparent sein müsse. „Öffentlich im präzisen Sinne ist eine Institution der Allgemeinheit nur dann, wenn potenziell allen ein Einblick in ihre Tätigkeit gewährt ist.“ (S. 91) Die komplexen Verflechtungen und die Größe der Gesellschaft schließen es aus, dass diese Transparenz in direkter Kommunikation hergestellt wird – dieser Einsicht entspricht bei uns, dass die Kommunikationsmittel der Rundfunk- und Fernsehanstalten prinzipiell geschützte und unabhängige sind. Die Lücke zwischen dem Einzelnen und dem Staatsapparat füllen repräsentative Systeme – etwa Parteien, Parlamente, Verbände –, deren Gefahr Bahrdt aber sehr klar benennt: „Da die Formen der Repräsentation, die eine politische Öffentlichkeit schaffen, vielfach die Gestalt eigener Institutionen annehmen, die von besonderen sozialen Gruppen getragen werden, ist stets die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie ein Eigenleben gewinnen. (…) Anstatt den schwer durchschaubaren Raum einer unvollständig integrierten Gesellschaft transparent zu machen, bedecken sie ihn mit einem Nebelschleier.“ (S. 97)
Fluchtburgen
Die Raffinesse in der Konzeption von Bahrdt besteht nun darin, dass das Private genau davon bedroht wird, dass das Politische nicht mehr öffentlich ist. Das Private – „bewußter Ausbau und Kultivierung der engsten sozialen und dinglichen Umwelt zu einem in sich geschlossenen System eigener Art“ (S. 99) – kann nur dann bestehen, wenn es nicht gestört wird. Und dazu bedarf es politischer Transparenz, weil „nur dort ein Eingriff in die Privatsphäre abgewehrt werden kann, wo die Ausübung politischer Macht öffentlich, d.h. auch kontrollierbar ist.“ (S. 105) Die Öffentlichkeit ist überall dort gefährdet, wo die Distanz zur Öffentlichkeit nicht gewahrt, nicht selbst gewählt werden kann, wenn es nicht mehr die eigene Entscheidung ist, wie und nach welchen Prämissen die Person handelt und damit auf gewisse Weise fremdbestimmt wird. Öffentlichkeit wird also auch durch die Entwickungen auf dem Immobilienmarkt unterhöhlt.
 Aber so wie das Private durch das Öffentliche gefährdet werden kann, kann das Öffentliche durch das Private gefährdet sein. Fehlt dem Privaten der Gegenpart, die Möglichkeit, öffentliche Abläufe zu verfolgen und auf sie Einfluss zunehmen, degenerieret auch das Privatleben zu einem „Glück im Winkel“, einer „Fluchtburg“: „Irgendwo im Diesseits versucht man, ohne die Welt im ganzen zu verändern, ein kleines Jenseits zu etablieren“. (S. 140) Ähnlich wie Carolin Emcke spricht Bahrdt davon, dass zur Öffentlichkeit auch die Anerkennung trotz Fremdheit gehört: „Das Verhalten ist geprägt durch eine resignierende Humanität, die die Individualität des anderen auch dann respektiert, wenn keine Hoffnung besteht, sie zu verstehen“ (S. 164) – aber gerade diese Anerkennung ohne das Verstehen, ohne dass der Fremde in die eigene Welt, im äußersten Fall in ein geschlossenes System integriert wird, ist die politische Dimension der Öffentlichkeit, die ihre Entsprechung in Transparenz und Kontrolle der politischen Amtsträger hat. Ist diese Qualität nicht gegeben, entsteht ein Teufelskreis: „Die Stadt erscheint als bedrohliches Ungeheuer, ein Grund, um sich noch mehr in die Privatsphäre zurückzuziehen. (…) So kommt es, dass der Großstädter (…) dem romantischen Gerede von der Intaktheit und Gebrogenheit ländlichen Lebens glaubt und an Flucht denkt.“ Was fatale Wirkung hat: „Wenn der Großstädter selbst beginnt, die Großstadt zu verneinen, (…) dann verzichtet er nicht nur auf jede Teilnahme an einer städtischen Öffentlichkeit, sondern lässt gleichzeitig ein Chaos entstehen, das die Voraussetzungen für das Neuentstehen einer städtischen Öffentlichkeit vernichtet.“ (S. 165f.) (5)
Aber so wie das Private durch das Öffentliche gefährdet werden kann, kann das Öffentliche durch das Private gefährdet sein. Fehlt dem Privaten der Gegenpart, die Möglichkeit, öffentliche Abläufe zu verfolgen und auf sie Einfluss zunehmen, degenerieret auch das Privatleben zu einem „Glück im Winkel“, einer „Fluchtburg“: „Irgendwo im Diesseits versucht man, ohne die Welt im ganzen zu verändern, ein kleines Jenseits zu etablieren“. (S. 140) Ähnlich wie Carolin Emcke spricht Bahrdt davon, dass zur Öffentlichkeit auch die Anerkennung trotz Fremdheit gehört: „Das Verhalten ist geprägt durch eine resignierende Humanität, die die Individualität des anderen auch dann respektiert, wenn keine Hoffnung besteht, sie zu verstehen“ (S. 164) – aber gerade diese Anerkennung ohne das Verstehen, ohne dass der Fremde in die eigene Welt, im äußersten Fall in ein geschlossenes System integriert wird, ist die politische Dimension der Öffentlichkeit, die ihre Entsprechung in Transparenz und Kontrolle der politischen Amtsträger hat. Ist diese Qualität nicht gegeben, entsteht ein Teufelskreis: „Die Stadt erscheint als bedrohliches Ungeheuer, ein Grund, um sich noch mehr in die Privatsphäre zurückzuziehen. (…) So kommt es, dass der Großstädter (…) dem romantischen Gerede von der Intaktheit und Gebrogenheit ländlichen Lebens glaubt und an Flucht denkt.“ Was fatale Wirkung hat: „Wenn der Großstädter selbst beginnt, die Großstadt zu verneinen, (…) dann verzichtet er nicht nur auf jede Teilnahme an einer städtischen Öffentlichkeit, sondern lässt gleichzeitig ein Chaos entstehen, das die Voraussetzungen für das Neuentstehen einer städtischen Öffentlichkeit vernichtet.“ (S. 165f.) (5)
Einschalten
Nun sind fast 60 Jahre seit der Erstveröffentlichung von „Die moderne Großstadt“ vergangen. Dennoch bleiben wesentliche Gedanken aktuell – und sie sich zu vergegenwärtigen ist gerade in diesen Tagen besonders wichtig. Dabei geht es ja nicht nur darum, die Eingriffe in den Privatraum abzuwehren, deren Versuchung unter dem Druck der aktuellen Lage besonders groß zu sein scheint, gerade auch von solchen Maßnahmen, deren Wirkung höchst umstritten ist wie das Tracken von Smartphones, um Kontaktketten rückverfolgen zu können. (6) Es geht auch darum, sich ungebrochen vehement danach zu fragen, ob das System der Repräsentationen, in dem durch das politische Entscheidungen getroffen werden, seinen Anspruch an Repräsentation tatsächlich noch erfüllt. Und es geht darum zu fragen, wie die Möglichkeiten zu politischer Einflussnahme wieder erhöht werden könnte, um den öffentlichen Raum öffentlich zu machen. Die aktuelle Lage ist nicht zuletzt eine Folge von gravierenden Fehleinschätzungen und Fehlentwicklungen, die als vermeintlich alternativlos präsentiert wurden, die nie wirklich in dem Sinne öffentlich waren, als dass sie zur Diskussion gestanden hätten. Und die sich schon seit einiger Zeit als Bumerang erweisen – auf dem Wohnungsmarkt, in der Bodenpolitik, in der Finanzpolitik. Und eben auch im neoliberal zurechtgestutzten Gesundheitswesen mit den mies bezahlten Pflegekräften. Die Schieflagen drohen sich durch den wirtschaftlichen Shutdown erheblich zu verschärfen.
 Privat und öffentlich gehören nicht in erster Linie – nach Bahrdt – als formale Idee des Städtebaus zusammen. Kaum zufällig gibt es die Vorstellung des Halböffentlichen bei Bahrdt nicht. Wird die Polarität von öffentlich und privat nicht politisch gedacht, kann daraus kaum anderes entstehen als eine hohle Kulisse. Auch für Städtebauer sollte die Wohnung mit im Blick haben und die Stadtplanung nicht nur vom öffentlichen Raum, sondern genauso vom Privatraum her zu denken und zu entwickeln – wie es Bahrdt im übrigen auch vorschlägt: die Stadtplanung „gedanklich beim Privatraum beginnen zu lassen“ (S. 176). Das Private zu schützen wäre aber nur der eine Teil. Es muss auch darum gehen, die Fragen nach den Entscheidungsstrukturen und dem Einfluss der Öffentlichkeit auf diese zu hinterfragen und neu zu denken. Bahrdt beschwört zum Schluss seines Textes dem Mut zur Utopie: „Wir werden niemals in Großstädten leben, die einheitlich widerspruchslos aus dem Geist einer Epoche oder gar einer Theorie geplant sind. Und es ist auch fraglich, ob wir die wünschen sollten. Aber der Zwang, mit dem bereits Vorhandenen irgendwie zurecht zukommen, schließt nicht ein, dass man sich dem Althergebrachten stets unterordnen muss. In vielen Fällen ist es möglich, das bereits Bestehende in ein neues System einzubeziehen, es gewissermaßen ,umzudeuten‘, oder ihm nachträglich einen Sinn zu verleihen, falls es vorher keinen gehabt hat. Den Mut und die Idee zu einer solchen Umdeutung kann nur die Utopie, niemals die Erfahrung geben.“ (S. 186)
Privat und öffentlich gehören nicht in erster Linie – nach Bahrdt – als formale Idee des Städtebaus zusammen. Kaum zufällig gibt es die Vorstellung des Halböffentlichen bei Bahrdt nicht. Wird die Polarität von öffentlich und privat nicht politisch gedacht, kann daraus kaum anderes entstehen als eine hohle Kulisse. Auch für Städtebauer sollte die Wohnung mit im Blick haben und die Stadtplanung nicht nur vom öffentlichen Raum, sondern genauso vom Privatraum her zu denken und zu entwickeln – wie es Bahrdt im übrigen auch vorschlägt: die Stadtplanung „gedanklich beim Privatraum beginnen zu lassen“ (S. 176). Das Private zu schützen wäre aber nur der eine Teil. Es muss auch darum gehen, die Fragen nach den Entscheidungsstrukturen und dem Einfluss der Öffentlichkeit auf diese zu hinterfragen und neu zu denken. Bahrdt beschwört zum Schluss seines Textes dem Mut zur Utopie: „Wir werden niemals in Großstädten leben, die einheitlich widerspruchslos aus dem Geist einer Epoche oder gar einer Theorie geplant sind. Und es ist auch fraglich, ob wir die wünschen sollten. Aber der Zwang, mit dem bereits Vorhandenen irgendwie zurecht zukommen, schließt nicht ein, dass man sich dem Althergebrachten stets unterordnen muss. In vielen Fällen ist es möglich, das bereits Bestehende in ein neues System einzubeziehen, es gewissermaßen ,umzudeuten‘, oder ihm nachträglich einen Sinn zu verleihen, falls es vorher keinen gehabt hat. Den Mut und die Idee zu einer solchen Umdeutung kann nur die Utopie, niemals die Erfahrung geben.“ (S. 186)
Wie zeitgemäß dies ist zeigt sich darin, dass sich daran direkt einen Ausschnitt aus Carolin Emckes Rede von 2016 anschließen lässt: „Dazu braucht es nur Vertrauen in das, was uns Menschen auszeichnet: die Begabung zum Anfangen. Wir können hinausgehen und etwas unterbrechen. Wir können neu geboren werden, in dem wir uns einschalten in die Welt. Wir können das, was uns hinterlassen wurde, befragen, ob es gerecht genug war, wir können das, was uns gegeben ist, abklopfen, ob es taugt, ob es inklusiv und frei genug ist – oder nicht.“ (7) Viel ist unterbrochen in diesen Tagen. Um so wichtiger wird es, dass wir uns einschalten in die Welt.
(1) Carolin Emcke: Anfangen. Dankesrede anlässlich der Verleihung des Freidenspreises des Deutschen Buchhandels
(2) Alle Zitate entnommen der von Ulfert Herlyn herausgegbeen Ausgabe von 1998. Leske Budrich, Opladen
(3) Sascha Lobo: Wider die Vernunftpanik. Spiegel.de, 18. März >>>
Darin heißt es: „Wenn der richtige Notfall eintritt, ist eine übergroße Mehrheit bereit, Grundrechte über Bord zu werfen. Und Leute übel zu beschimpfen, die das auch nur diskutieren wollen. Die Vernunftpanik verhindert Debatten. Dabei ist auch eine sinnvolle Grundrechtseinschränkung eine Grundrechtseinschränkung, über die diskutiert werden kann und muss. Man kann gegen Ausgangssperren argumentieren und trotzdem kein Massenmörder sein. (..) Was mit Corona gerechtfertigt wird, wird danach viel einfacher in viel milderen Fällen zu rechtfertigen sein.“
(4) Damit, die Öffentlichkeit nicht tatsächlich bestimmen zu können, ist Bahrdt nicht alleine. Auch Hannah Arendt, die dem Öffentlichen und dem Privaten in „Vita activa“ ein langes Kapitel gewidmet hat, wird kaum konkreter, aber auch sie betont, dass die Öffentlichkeit und das Gemeinsame eine Konstruktion ist – und deswegen immer wieder neu hergestellt werden muss. Der öffentliche Raum, so Arendt, sei das Gemeinsame, was bedeute, „dass alles, was vor der Allgemeinheit erscheint, für jedermann sichtbar und hörbar ist, wodurch im größtmögliche Öffentlichkeit zukommt. (…) Der Begriff des Öffentlichen bezeichnet zweitens die Welt selbst, insofern sie das uns Gemeinsame ist (…) Doch ist dies weltlich Gemeinsame keinsewegs identisch mit der Erde der der Natur im Ganzen (…) Die Welt ist vielmehr sowohl ein Gebilde von Menschenhand wie der Inbegriff aller nur zwischen Menschen spielenden Angelegenheiten, die handgreiflich in der hergestellten Welt zum Vorschein kommen.“ Hannah Arendt. Vita activa oder Vom tätigen Leben. München/Berlin/Zürich 2002 (1967), S. 62/65f.
(5) Bemerkenswert ist, wie gut auch hier auf Hannah Arendt verwiesen werden kann, die die Bedrohung durch die gestörte Balance aus Vita activa und Vita contemplativa sieht: „Erst als die Vita activa ihre Ausrichtung auf die Vita contemplativa verlor, konnte sie sich als tätige Leben voll entfalten; und nur weil dieses tätige Leben ausschließlich auf Leben als solches ausgerichtet war, konnte der biologische Lebensprozess selbst, der aktive Stoffwechsel des Menschen mit der Natur, wie er sich in der Arbeit verwirklichte, so ungeheuer intensiviert werden, dass seine wuchernde Fruchtbarkeit schließlich die Welt selbst und die produktiven Vermögen, denen sie ihre Entstehung dankt, in ihrer Eigenständigkeit bedroht. (…) In ihrem letzten Stadium verwandelt sich die Arbeitsgesellschaft in eine Gesellschaft von Jobholders, und dies verlangt von denen, die ihr zugehören, kaum mehr als ein automatisches Funktionieren, als sei das Leben des Einzelenn bereits völlig untergetaucht in den Strom des Lebensprozesses, der die Gattung beherrscht, und als bestehe die einzige aktive, individuelle Entscheidung nur noch darin, sich gleichsam loszulassen, seine Individualität aufzugeben bzw. die Empfindungen zu betäuben, welche noch die Mühe und Not des Lebens registrieren, um dann völlig ‚beruhigt‘ desto besser und reibungsloser ‚funktionieren‘ zu können.“ Hannah Arendt. Vita activa oder Vom tätigen Leben. München/Berlin/Zürich 2002 (1967), S. 407/410f.
(6) Eine bedrückende Liste von der Lage unangemessenen Einschränkungen von Rechten hat Kai Biermann in der Zeit aufgelistet: Der Rechtsstaat leidet unter Corona >>>
(7) wie (1)