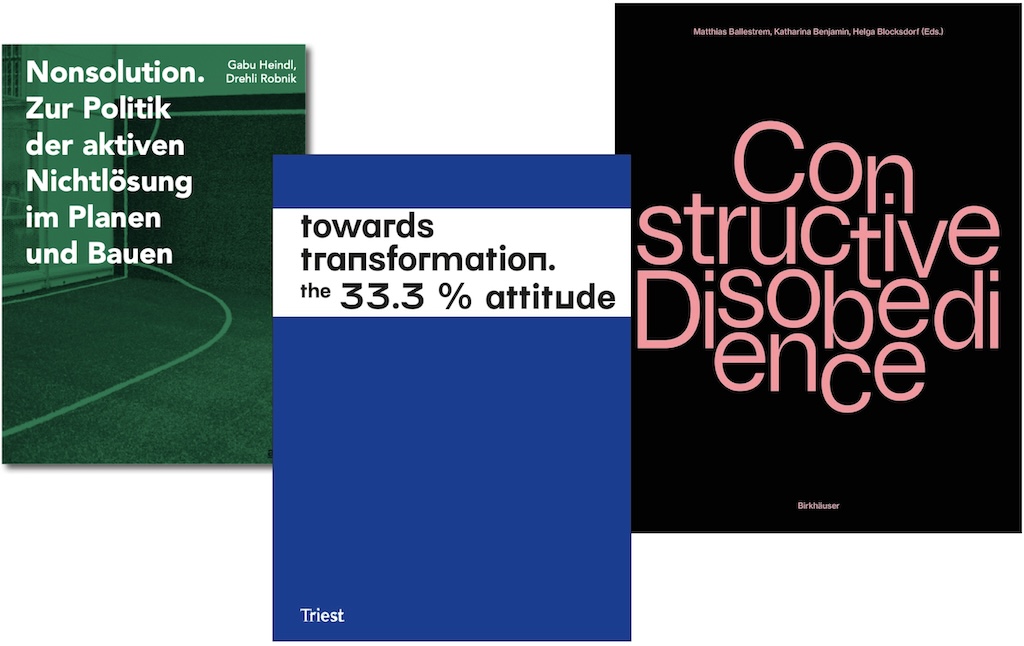 Wie finden wir zu einem architektonischen Handeln, das den Problemen der Gegenwart gerecht wird? Der Weg zu einem anderen Bauen wird in der Theorie reflektiert, in der Lehre geebnet, in der Praxis vollzogen – wie drei Neuerscheinungen belegen.
Wie finden wir zu einem architektonischen Handeln, das den Problemen der Gegenwart gerecht wird? Der Weg zu einem anderen Bauen wird in der Theorie reflektiert, in der Lehre geebnet, in der Praxis vollzogen – wie drei Neuerscheinungen belegen.
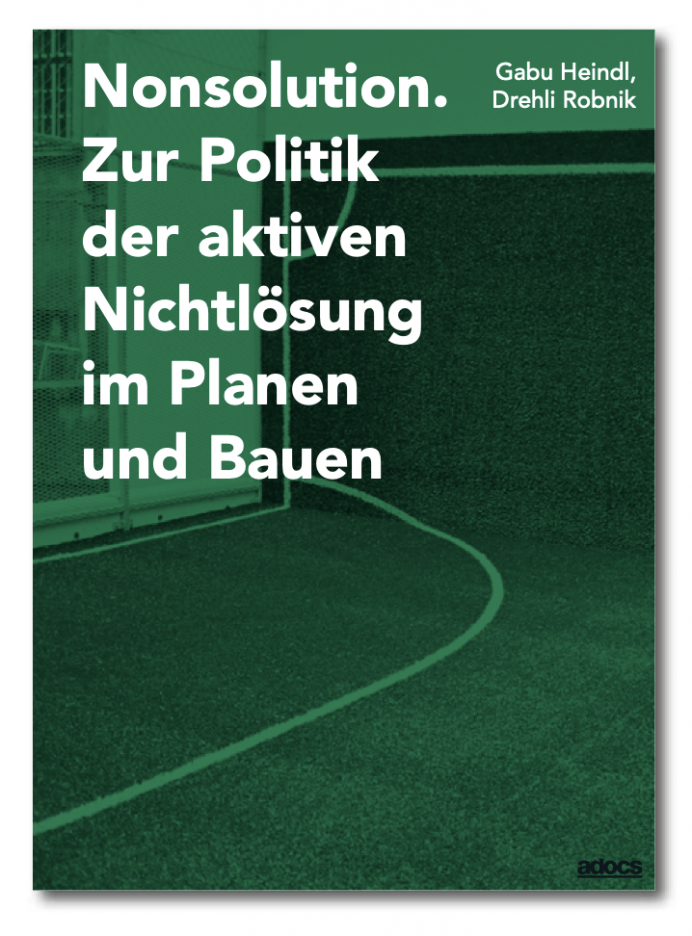
Gabu Heindl, Drehli Robnik: Nonsolution. Zur Politik der aktiven Nichtlösung im Planen und Bauen. 110 Seiten, 10 Abbildungen, 12,3 × 18 cm, 18 Euro
adocs Verlag, Hamburg, 2024
Gerade mal etwa 80 Seiten Text, ein Buch, das sich auf einer etwas längeren Zugreise bequem lesen lässt. Aber Vorsicht. Bequem geht es nicht zu, Gabu Heindl und Drehli Robnik greifen in ihrem Essay die Vorstellung auf, dass Architektur Probleme lösen könne. Wie der Titel vermuten lässt, lehnen sie diese Vorstellung ab. Aber, und das ist der Grund, warum es sich lohnt, diesen Essay zu lesen, sie entwerten damit weder Architektur, geschweige denn dass sie dem desillusioniertem Nichtstun Vorschub leisten. Im Gegenteil geht es darum, Dilemmata zu erkennen und dennoch handlungsfähig zu bleiben. Und damit ein Potenzial von Architektur zu stärken: das, politisch relevant zu sein.
Der Begriff „nonsolution“ ist den späten Schriften von Siegfried Kracauer entlehnt. Nonsolution werde bei ihm „zu einer hochverdichteten Beziehung für die (…) Möglichkeit, Wirklichkeit in ihrer Kontingenz zu erfahren.“ Heindl (Architektin, Professorin für Bauökonomie und Aktivistin) und Robnik (Autor und Kritiker mit den Schwerpunkten Politik, Geschichte und Film) wenden dieses Konzept der Wirklichkeitserfahrung ins Politische, Planerische und Architektonische. Sie machen eine „reflexionslose Lösungsversesssenheit“ aus, die bewirkt, dass die politische Dimension architektonischen und planerischen Handelns unter einer vermeintlichen und behaupteten Alternativlosigkeit verschwindet – man denke nur an das Credo, man müsse „bauen, bauen, bauen“, um den Mangel an bezahlbarem Wohnen zu beheben. Diese Versessenheit findet die Lösungen immer nur im Rahmen des Vorgegebenen und damit auch im Rahmen der existierenden Machtverhältnisse, die damit gefestigt werden. Das Konzept Nonsolution erlaubt es demgegenüber nicht nur, sich einer solchen schon vorab strukturierten Lösung zu widersetzen, sondern dieses Vorstrukturieren zu kritisieren und seine machtstabilisierende Wirkung sichtbar zu machen.
Dass damit auch das Nichtbauen eine Option ist, wird mit Verweis auf Lucius Burckhardt erläutert, ebenso, dass so erst der Raum für die Diskussion darüber geöffnet werden kann, wie Gerechtigkeit verstanden werden kann, wie die ermächtigt werden können, die in der gesellschaftlichen Hierarchie keine Rolle spielen. Handlungsfähig bleiben heißt auch, die Diskussion über das Unlösbare nicht versiegen zu lassen und dennoch nach Wegen zu suchen, die zwischen Möglichem und Wünschenswertem, zwischen verschiedenen nicht gleichzeitig erreichbaren Zielen verlaufen. Auch Zeit zu gewinnen, um Diskussionen überhaupt erst zuzulassen, kann deswegen eine Option des Nonsolution sein, ebenso wie es eine sein kann, das umzusetzen, was nur in Teilen das eigentlich Gewünschte verwirklicht – als Vorgriff auf Zukünftiges.
Heindl und Robnik geht es darum, das Zukünftige mitzudenken und so Handlungsspielräume im Zukünftigen zu bewahren.
Der knappe und sehr dichte Text fordert gründliches Lesen, ist gespickt mit vielen, auch überraschenden Referenzen (wie es die Kracauers sein mag). Er ist ein wichtiger Einwand gegen all die, die Ökologie gegen soziale Gerechtigkeit meinen ausspielen zu können (und dabei keinem von beiden gerecht werden), die Lösungen einfordern, weil sie die Diskussion scheuen. Die brauchen wir aber dringend.

ETH-Studio Jan De Vylder, Jan De Vylder, Oliver Burch, Jakob Junghanss, Lukas Ryffel (Hg.): Towards Transformation. The 33.3 % Attitude. Zurich. 232 Seiten, 310 Abbildungen, 26,5 × 19,5 cm, englisch, 39 Euro
Triest Verlag, Zürich, 2024
Mit einer auf Semesterprojekten aufbauenden Publikation, mit einer anderen, aber durchaus nicht unähnlichen Argumentation wie Heindl/Robnik regen Jan de Vylder, Oliver Burch, Jakob Junghanss und Lukas Ryffel dazu an, die übliche Praxis zu hinterfragen. Sie und die Studierenden des auf drei Jahre angelegten ETH-Studios 33,3% haben sich dabei mit dem Wohnungsbau in Zürichs Metropolregion beschäftigt. Der größte Teil des Wachstums dieser Region der letzten zwanzig Jahre stamme aus Projekten des Ersatzneubaus. Wie unbefriedigend diese vor allem in den Randbereichen von Zürich geübte Praxis, die längst nicht nur einzelne Häuser, sondern mitunter ganze Siedlungen erfasst, zeigen im Buch dokumentierte Beispiele. Aber es kommt nicht nur darauf an, das Neue gegen das Alte auszuspielen, sondern eine neue Haltung zum Baugeschehen zu finden und zu den Möglichkeiten, den Bestand zu nutzen, zu verbessern, ihm neue Möglichkeiten zu erschließen – oder ihn einfach auch erst einmal so zu lassen, wie er ist. Lösungen seien das Produkt aus fehlender Freiheit und selbstgefälliger Zufriedenheit, wird mit Verweis auf Sigmar Polke postuliert. Der hohe Verwertungsdruck unterminiert, so wird suggeriert, die Freiheit des Architekten.
In den Zeiten, in denen sich die Welt wandle und wandeln müsse, brauche es eine andere Haltung. Diese Haltung wird hier die 33,3%-Haltung genannt. Mit ihr wird keine umfassende Lösung angestrebt – eben keine hundertprozentige, sondern eine in kleinen Schritten.
Ein Drittel Umbau, ein Drittel einfach so lassen wie es ist und ein Drittel des Geländes überdachen, damit sich dort etwas entwickeln kann, was von den Nutzer:innen und Bewohner:innen kommt – so könnte das aussehen. Drei verwirklichte Projekte von de Vylders Büro AJDVIV dienen der einführenden Einstimmung; mit 22 Fallstudien wird dieses Prinzip des kleinen Eingriffs fanasievoll vorgeführt. Eine Parkgarage wird zu einer Landschaft, Einfamilienhäuser wachsen mit verschiedensten Anbauten zusammen, von Kinderzeichnungen inspiriert wird eine Schule zu einem wild wuchernden Raumerlebnis erweitert.
Die Entwürfe sind so assoziativ wie es der Aufbau des Buches ist. Einfälle, Zitate werden gemischt mit einer Studie zum Zürcher Wohnungsbau der jüngeren Zeit, dazu kommen Interviews, in denen junge Architekt:innen, erfahrene Planer:innen sowie Künstler:innen zu Wort kommen. In sieben Prinzipien werden die Entwürfe der Studierenden geordnet, auch sie eher assoziativ: Sie heißen etwa „Kollision durch Begegnung“, „Präsenz ist der Schlüssel“ oder „time can tell“. Das Buch und die Inhalte sind also insgesamt so spielerisch, manchmal etwas sprunghaft aufgebaut und aufgearbeitet, wie es die Entwurfsmethode nahelegt – und auch in Sachen Grafik und Papier sehr ansprechend gestaltet. Entsprechend sind die 33,3%-Verteilungen in den Entwürfen dann auch nicht wörtlich zu nehmen – das wäre dann wohl doch zu exakt.
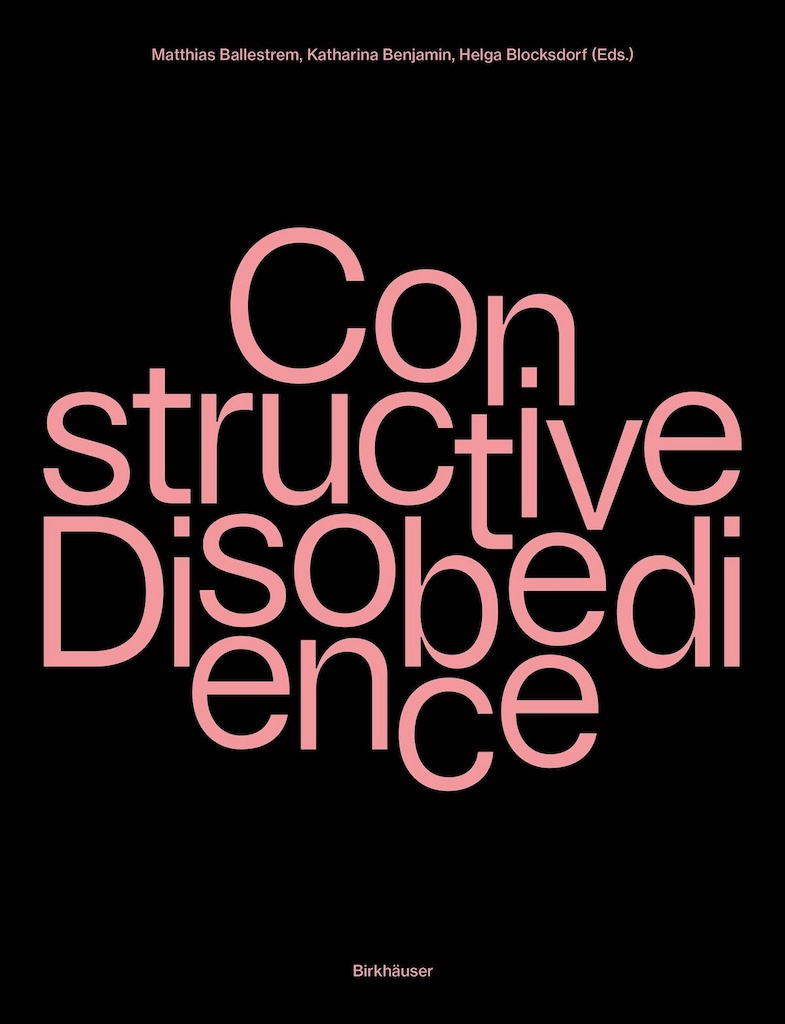
Matthias Ballestrem, Katharina Benjamin., Helga Blocksdorf (Hg.): Constructive Disobedience. An Experimental Methodology in Architecture. 296 Seiten, 23 x 30 cm, 200 teils farbige Abbildungen, 54 Zeichnungen, englisch, 52 Euro
Birkhäuser Verlag, Basel, 2024
„Konstruktiver Ungehorsam“ dokumentiert die Suche nach Wegen in eine andere Praxis des Bauens und setzt dabei auf das Experiment. Jedes Experiment enthalte die Möglichkeit des Scheiterns, aber in der architektonischen Praxis liege das damit verbundene Risiko auf den Schultern der Architekt:innen, so Helga Blocksdorf in der Einleitung – und eben nicht auch auf Baufirmen oder Auftraggebenden.
Das Buch basiert auf einer zweitägigen Konferenz, die 2022 in Braunschweig stattfand und über den Lehrstuhl von Blocksdorf initiiert wurde. Die Teilnehmenden wurden über einen Aufruf gefunden; der hatte dazu aufgefordert, Wege des Experimentierens aufzuzeigen. Gesucht waren Menschen, die das Eperiment wagen und die die daraus sich ergebenden Erkenntnisse zu einem Teil der Praxis in Lehre, Forschung und im Bauen machen wollen.
Ungehorsam heißt also, sich dem Weg des geringen Widerstands zu widersetzen und nach anderen Konstruktionen, Materialien, Prozessen zu suchen, um das Bauen aus der Starre der risikioarmen Routine zu lösen, die zu einer Fülle von Verordnungen und Vorgaben, zu von großen Firmen bereitgestellten Systemen und zu einer ästhetischen Trostlosigkeit führen.
19 Beispiele für solch konstruktiven Ungehorsam sind in diesem Buch versammelt und dokumentiert, Testbauten, die im universitären Kontext entstanden sind, Materialexperimente und Mock-Ups als Test- und Überzeugungsinstrument, konstruktive Erweiterungen des Bekannten wie vorgespannter Lehm, Bauten mit Stroh, Reet, Holz, Receyclingmaterial, phänomenologische Untersuchungen und das Aktivieren alten Wissens werden gezeigt. Zu den Protagonisten, die überwiegend aus Deutschland und der Schweiz, aber auch aus England, Uruguay, Kuba und den USA kommen, gehören Oda Pälmke, Roger Bolltshauser, summa cum femmer, Nicklas Fanelsa, Summer Islam, Susanne Brorson, Ruth Morrow oder Albor Arcquitectos. Die Beiträge sind jeweils auf ein Projekt fokussiert, das in seinem Entstehungsprozess und seinen Rahmenbedingungen, aber auch in gut aufgearbeiteten Konstruktionszeichnungen vorstellt werden.
Ein einzelnes Projekt sei bedeutungslos, erst in der Überlagerung mit anderen Experimenten könne eine produktive Wissenslandschaft entstehen, so zitiert Matthias Ballestrem Hans-Jörg Rheinberger in seiner Bilanz der Vorträge und Gespräche. Das macht einerseits deutlich, wie wichtig solche Konferenzen sind, damit Menschen voneinander wissen und voneinander lernen, es macht aber auch deutlich, dass es mit einer Konferenz oder Publikation nicht getan ist und die hier ausgelegten Fäden von anderen aufgenommen werden müssen, damit sich eine Kultur des Experimentierens enstehen kann – so wie ja auch diese Publikation, diese Konferenz bereits Gedachtes und Gewagtes zusammenführt. Neben Repräsentanten aus Politik und Verwaltung braucht es dafür aber vor allam auch die Unternehmen, die Firmen, Praktiker:innen der Ausführung, so Katharina Benjamin – die allerdings hier nicht vertreten sind; möglicherweise ist das einer Folgekonferenz vorbehalten. Gesprächsbedarf besteht allemal. So macht Benjamin auch auf darauf aufmerksam, dass, folgt man den Berichten der Versicherer, die Bauschäden zunehmen, trotz der wachsenden Zahl von Standards, Normen und Vorschriften. Noch ein Grund mehr, sich über eine andere Praxis Gedanken zu machen und den Austausch darüber zu fördern.

