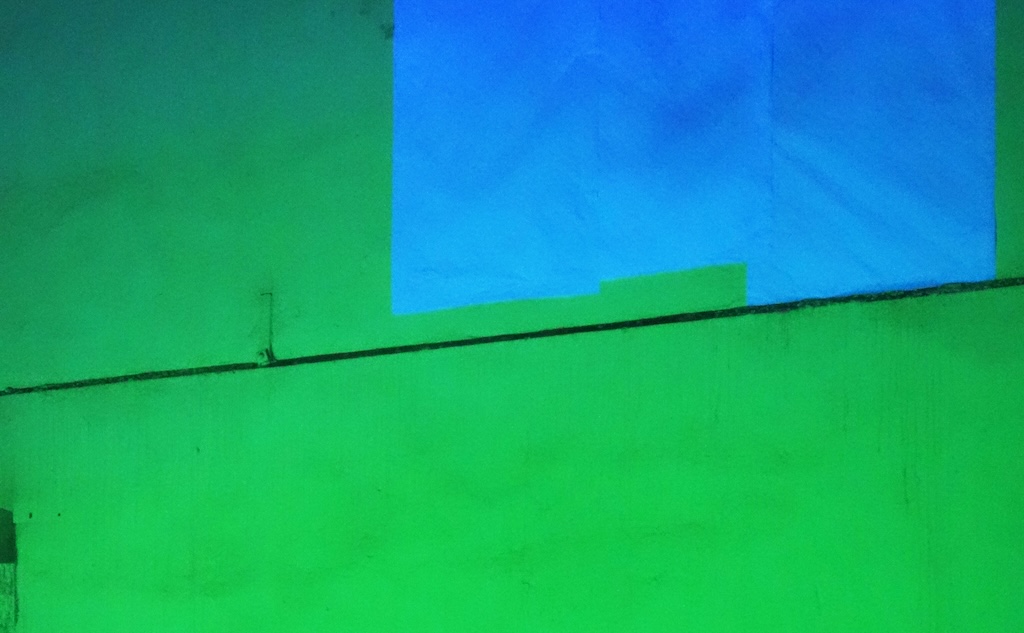Wie sieht die Zukunft der Architekturpraxis aus? Eine Antwort auf diese Frage gibt die Gegenwart. Eine Antwort geben die, die heute das Morgen gestalten, die noch länger als andere mit den Konsequenzen des Handelns von heute zu leben haben werden. Wir sollten uns für das interessieren, was sie tun.
Die Architekturgalerie am Weißenhof in Stuttgart zeigt im Herbst die Ausstellung „Und jetzt – Akute Positionen junger Büros zu Architektur und Planung“. Dieser Text ist der erste einer Serie von Beiträgen zur Ausstellung.
Die Entwicklungen in den letzten Jahren scheinen in eine eindeutige Richtung zu weisen. Der Anteil der Angestellten unter den Architekt:innen steigt, die Büroneugründungen nehmen ab. 2021 waren mehr als 6000 weniger „Unternehmen auf dem Architekturmarkt in Deutschland“ verzeichnet als 2012 (1), von den knapp 142.000 in den Architekten- und Stadtplanerkammern eingetragenen sind Anfang 2023 nur noch 38 Prozent freischaffend. 2017 waren es noch 42 Prozent. (2)
Erklärungen dafür gibt es viele. Die Sicherheit, auf dem Arbeitsmarkt gefragt zu werden, hat in den letzten Jahren die Schwelle erhöht, den risikobehafteten Weg in die Selbstständigkeit zu gehen. Der Beruf ist komplexer geworden und deswegen in etablierten Teams besser zu bewältigen. Regeln und Verordnungen haben zugenommen, Bauherrschaften sind oft Firmen mit Gremien, innerhalb derer die Personen wechseln können und eine weniger enge persönliche Bindung zur Bauaufgabe haben, die sie in Auftrag geben. Haftungs- und Versicherungsrisiken sind größer geworden. All dies lädt nicht gerade zur Neugründung eines Büros ein.
Der Haken der Statistik
Vorwürfe an eine vermeintlich verweichlichte Gen Z in der Kuschelrepublik Deutschland (3) zielen zumindest auf diesem Berufsfeld also schon einmal insofern ins Leere, als es gerade für die jungen Berufstätigen schwerer geworden ist, ein Büro zu gründen. Und auch der schon nicht mehr so ganz nahen Vergangenheit mögliche Weg in die Selbstständigkeit, der Wettbewerb, ist kaum noch eine Alternative. Der Anteil der Wettbewerbe an „architektenrelevanten Ausschreibungen“ ist zwischen 2011 und 2021 von 30,2 auf etwas mehr als 7,6 Prozent zurückgegangen. (4) Und von den 407 Wettbewerben in 14326 Ausschreibungen waren 2021 lediglich 26 offene, 2017 waren es immerhin noch 51, 2018 56 gewesen. Die Bereitschaft, jungen Büros Chancen zu geben, fehlt viel zu oft bei denen, die Aufträge vergeben. Hier regiert meist die lähmende und jedes Ausloten neuer Ideen behindernde Sicherheitsdenken. In vielen Fällen werden die Zugangsbeschränkungen deutlich strenger als vorgeschrieben gefasst, so dass junge oder kleinere Büros kaum Zugang zu diesen Verfahren haben. Die Möglichkeiten, ihnen eine realistische Chance einzuräumen, werden kaum je genutzt. Man sollte sich also vor schnellen Urteilen hüten, wenn man über die jüngeren Architekt:innen spricht.
Das Nachdenken über Zukunft von jungen Absolvent:innen ist demnach auch eines über die Architekturpraxis generell. Experimente, eine Praxis, die aktuelle Herausforderungen reflektiert, aufgreift und berücksichtigt, hat es schwer. Deswegen darf man noch etwas tiefer bohren. Denn die hier genannten Zahlen erfassen nur einen Teil der Wahrheit. Gemein ist den üblichen Erklärungsmustern, dass sie von einem unveränderten Bild der Berufspraxis ausgehen. Was sie nicht berücksichtigen, sind neue Praktiken, neue Arbeitsformen, neue Aufgabengebiete. Architekt:in und Stadtplaner:in sind geschützte Berufsbezeichnungen, die Architekten- und Stadtplanerkammern sind die Instanzen, die diesen Titelschutz gewährleisten. Es liegt auf der Hand, dass sie den Änderungen in der Berufspraxis nur zögernd folgen, das ist ja gerade Teil der Titelschutz-Logik. Es soll ja nicht beliebig und kurzfristig geändert werden, unter welchen Voraussetzungen man sich Architekt:in oder Stadtplaner:in nennen darf, dann wäre der Titelschutz nicht viel wert und wenig verlässlich. Zunächst einmal heißt das aber, dass in Statistiken über Architekt:innen und Stadtplaner:innen unsichtbar bleiben, die mit dem Wissen, das sie an den Hochschulen und Universitäten gewonnen haben, anders umgehen, als es den Erwartungen entspricht.

Stadt verändern, indem man sie neu nutzt und neue Sichtweisen ermöglicht. Das muss nicht für die Ewigkeit sein. Für das im Rahmen des Festivals Theaterformen veranstaltete „Stadtlabor“ (Hannover) hat die Gruppe Endboss die Festivalarchitektur errichtet. (Bild: Festival Theaterformen, Stadtlabor, Endboss, Foto: Moritz Küstner)
Eine gute Idee

Das Hochhaus An der Urania 4-10 in Berlin (Werner Düttmann) soll durch einen Neubau ersetzt werden. Die Initiative „an.ders URANIA“ erstellte eine “Machbarkeitsstudie von unten”, in der sie darlegten, wie das Gebäude an der Urania 4-10 erhalten, saniert und umgebaut werden kann. Der Eigentümer, das Land Berlin hatte eine solche Studie nicht beauftragt. Der Abriss hat bereits begonnen. (Bild: Titel der Machbarkeitsstudie)
Und das sollte uns interessieren. Und zwar nicht nur, weil es immer eine bessere Idee ist, sich für das zu interessieren, was junge Menschen machen und warum sie es machen, als sie in irgendwelche Schubladen zu stecken. Es sollte uns interessieren, weil es hier darum geht, wie man heute sinnvoll über Architektur und Stadt nachdenken kann. Weil diese andere, unkonventionelle Praxis vielleicht genau die ist, die konventionell, die zur Regel werden sollte, wenn wir es ernst damit meinen, im Bestand nach Lösungen danach zu suchen, wie wir in Zukunft zusammenleben wollen. Wenn wir ernst nehmen, dass das Umnutzen und Umbauen, das Wiederverwenden, das Bewahren, das Pflegen, das Sanieren essenziell sind, um ein Überleben wahrscheinlicher zu machen, dann heißt das auch, dass selbst im Bewahren und Umnutzen vorsichtig und behutsam gehandelt werden muss. Energiebedarfe für Neubauten sind zu hoch, die CO2-Bilanz zu schlecht, als dass wir es uns leisten könnten, sich nicht viel intensiver um Erhalt und Nutzung des Bestehenden zu kümmern. Dann muss man genauer wissen, was der Bestand eigentlich kann. Was man mit dem machen kann, was es gibt. Das verlangt viel mehr als bislang auch ein szenografisches Denken, eine szenografische Praxis, ein Arbeiten mit den Mitteln, mit denen man das Bestehende neu entdecken kann, ohne neue Häuser bauen zu müssen. Das lässt sich auch mit Praktiken kombinieren, die Menschen miteinander ins Gespräch bringen, es ihnen erlaubt, neu und anders aufeinander zuzugehen.
Für all das muss man aber gut und viel nachdenken. Man muss zuhören und sich überlegen, was man braucht und was man vielleicht nur gerne hätte. Der Bestand ist immer auch ein sozialer Bestand: Es muss beim Arbeiten im Bestand Rücksicht auf die genommen werden, die ihn bislang genutzt haben, in deren Leben man eingreift, muss über die Beziehungen nachdenken, in die er eingebunden ist. Das heißt auch, dass man schon bevor man ans Bauen denkt, sich fragen sollte, wo Nachbarschaftsgefüge gestört sind, wo das Zusammenleben erschwert wird. Eine HOAI beispielsweise berücksichtigt ein entsprechendes Vorgehen kaum. Wenn wir den Ungerechtigkeiten auf dem Wohnungsmarkt etwas entgegensetzen wollen, ohne immer weiter für die zu bauen, die keine Wohnungen finden, müssen wir darüber nachdenken, wie man Wohnraum besser nutzt und gerechter verteilt. Wie man Ressourcen an Freiraum gerechter zugänglich macht, damit es einfacher wird, weniger Fläche in Anspruch zu nehmen.

Die Initiative zum Erhalt des Justizzentrums in München sieht sich als Teil einer Bewegung und erklärt sich solidarisch mit anderen Initiativen, die sich gegen den Abriss von Gebäuden wenden. Jetzt hat sie dazu aufgerufen, Ideen zur Zukunft des Gebäudes einzureichen. (BIld: Initiative JustizzentrumErhalten, Jakob Bahret)
Es geht um viel
Viele Initiativen, junge Kollektive, Büros machen genau das. Es sind inzwischen einige. Sie heißen Endboss, UVM (und vieles mehr), Rurbane Realitäten oder Projektbüro. Sie arbeiten in wechselnden Konstellationen, verbinden Projektarbeit, Aktivismus, Lehre, allein schon, weil nicht immer finanziell anerkannt wird, was sie leisten. Sie engagieren sich für einen anderen Umgang mit dem Bestand, für eine andere Form der Kommunikation, für Diskussionen, die auf verschiedenen räumlichen Ebenen das Zusammenleben verbessern, ohne dies mit einem Gebäude tun zu wollen. Sie organisieren Workshops und Gespräche, vermitteln Kenntnisse, klären Bedarfe. Entdecken Neues im Bestehenden. Viele von ihnen glauben immer weniger, dass man Probleme mit Gebäuden löst. Sie denken darüber nach, wie das Bauen eine Hilfe sein kann. Aber sie wissen, dass es immer nur ein Teil der Antwort ist. Sie berücksichtigen, was Lucius Burckhardt schon vor einigen Jahrzehnten festgestellt hat: dass es leicht ist, Architektur bei der Lösung von Problemen zu missbrauchen. Architektur gibt den Anschein, Probleme zu lösen, aber nur, wenn das Problem auf das reduziert wird, was ein Gebäude leisten kann. „Die Summe des vermeintlich Unwesentlichen, das bei dieser Verfahrensweise unter den Tisch fällt, schafft neue, größere Probleme“, so Burckhardt. Aus einem Problem wird ein Programm. Und weiter: „Um das Problem möglichst exakt zu machen, wird die Dynamik des zu lösenden Problems stillgelegt; ein momentaner Zustand wird einer „dauernden Lösung“ zugeführt. Indem sich die „Lösung“ als Maßanzug einem Problem überstülpt, blockiert sie dessen weitere Entwicklung, bis dann die Nähte aufplatzen.“ (5)

Die Versprechen der schönen Zukunft, die mit erst den neuen Projekten anbricht können nicht mehr so recht überzeugen. (Bild: Chrisstian Holl)
Wir müssen darüber diskutieren, wie diese Erkenntnis den Weg in die Mitte der Architekturpraxis findet. Das ist wichtig, weil neben den vielen interessanten, neuen Wegen, mit Architektur, Bestand, Stadt als auch einem sozialen Gebilde umzugehen, der konventionelle, immobilienwirtschaftliche Baubetrieb weiterläuft – sozial und ökologisch auf eine Weise unsensibel, wie wir es uns eigentlich schon lange nicht mehr leisten können. Eine Diskussion über das Berufsbild steht dringend an – hören wir denen zu, die dazu etwas zu sagen haben.