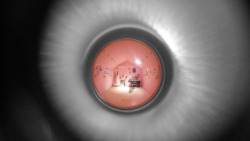Der Pritzker-Preis 2025 geht an Liu Jiakun. Obschon er bereits zweifacher Teilnehmer der Architekturbiennale in Venedig war (2008 und 2016), hatten Interessierte in Deutschland nur durch eine Ausstellung bei Aedes in Berlin 2017 die Gelegenheit, seine Arbeit kennenzulernen. Dass er nun mit dem wichtigsten Architekturpreis der westlichen Welt geehrt wird, überrascht nicht nur Fachleute. Ein Blick auf das Werk des nach Wang Shu zweiten Pritzker-Preisträgers aus China ist dennoch lohnend.
Liu Jiakun kommt 1956 in Chengdu zur Welt, der Hauptstadt der zentralchinesischen Provinz Sichuan. Die Mutter ist Internistin, und er verbringt weite Teile seiner Kindheit auf den Fluren des „Chengdu Second People’s Hospital“. 1978 nimmt er sein Architekturstudium an der Universität in Chongqing auf. Er bekennt heute, zunächst nicht ganz verstanden zu haben, was es bedeute, Architekt zu sein, aber „wie in einem Traum wurde mir plötzlich klar, dass mein eigenes Leben wichtig war.“ 1982 erlangt er den Bachelor-Abschluss und ist damit Teil jener ersten Generation von Absolvent:innen, die in einer Zeit des Umbruchs mit dem Aufbau Chinas betraut sind. Zunächst arbeitet Liu für das staatliche Chengdu Architectural Design and Research Institute, ehe er 1984 für zwei Jahre freiwillig ins tibetische Nagqu geht.
Film „Connecting Past, Present and Future“; The Pritzker Architecture Prize
Neben dem Schreiben und dem Malen, so sagt er heute, sei damals seine größte Stärke gewesen, „vor nichts Angst zu haben“. Tagsüber arbeitet er als Architekt, nachts ist er Schriftsteller. Dass er sich in der Folge nicht von der Architektur abwendet, liegt am Besuch der Einzelausstellung von Tang Hua, einem ehemaligen Studienkollegen, im Shanghai Art Museum. Er erfährt dort, dass es möglich ist, von der in der Volksrepublik vorgeschriebenen gesellschaftlichen Ästhetik abzuweichen, und seine Begeisterung für die Architektur erwacht aufs Neue. In der Folge baut er Kontakt zu Künstlern wie Luo Zhongli, He Duoling und dem Dichter Zhai Yongming auf und diskutiert mit ihnen über den Zweck und die Kraft von Architektur.
Wie Wasser
1999 gründet Liu Jiakun das eigene Architekturbüro in Chengdu, heute gehört es mit weiteren Standorten in Peking und Shanghai zu den etablierten Größen des Landes. Liu, der bis heute nie aufgehört hat, auch zu schreiben, umreißt seine architektonische Arbeit folgendermaßen: „Ich strebe immer danach, wie Wasser zu sein – einen Ort zu durchdringen, ohne eine feste Form zu haben, und in die lokale Umgebung und den Ort selbst einzusickern. Mit der Zeit verfestigt sich das Wasser allmählich und verwandelt sich in Architektur und vielleicht sogar in die höchste Form menschlicher geistiger Schöpfung. Dennoch behält es alle Qualitäten des Ortes bei, sowohl die guten als auch die schlechten.“
So sind in den letzten Jahren unterschiedliche Projekte – von ganz kleinen bis riesig großen – entstanden. Schon das 2002 fertiggestellte Luyeyuan-Stein-Skulpturen-Kunstmuseum in Chengdu macht deutlich, wie sehr gebauter Raum für Liu ein menschengemachtes Kulturgut ist, das sich auf verschiedenen Ebenen mit seiner Umwelt verzahnt. Fußwege und Brücken umgeben den Bau, durchmessen ihn und führen immer wieder zu Überschneidungen zwischen Innen und Außen; mit gebäudehohen Einschnitten in den steinernen Wänden wird diese Verbindung durch Fensteröffnungen inszeniert. Die Natur wird nicht imitiert, sondern als Kultur deren Teil. Bemerkenswert deutlich sollte diese Haltung 2021 bei der Renovierung des Tianbao-Höhlenbezirks über den Klippen von Erlang in Luzhou werden.
Bis 2006 entsteht auf dem neuen Campus des Sichuan Fine Arts Institute die Design Fakultät von Chongqing. Die sieben Gebäude belegen nicht nur die Fähigkeit des Architekten, ein derartig großes Raumprogramm auch auf städtebaulicher Ebene organisieren zu können, sondern unterstreichen auch seinen Willen, die Geschichten des Ortes formalästhetisch und atmosphärisch fortzuschreiben. Neben den verwendeten Materialien Schiefer, Backstein und dem mitunter roh gezeigten Beton, sind es auch die unterschiedlichen Dachformen der Gebäude, die deutlich auf die industrielle Prägung der Region Bezug nehmen. Außentreppen und Wege verbinden die Bauten auf den unterschiedlichen Niveaus der großzügigen Terrassen und des Erdbodens. Zwischen und über diesen Terrassen entstehen flexibel nutzbare Räume für die unterschiedlichen Funktionen des Hochschulbetriebs.
Mini bis maxi
Als am Nachmittag des 12. Mais 2008 ein Erdbeben der Stärke 7,9 MW seine Heimatregion Sichuan erschüttert, ändert sich auch die Arbeit von Liu Jiakun. Nach offiziellen Angaben werden rund 5,8 Millionen Menschen an diesem Tag obdachlos, fast 70.000 verlieren ihr Leben. Eine Person davon ist die 15-jährige Hu Huishan. Ihre Eltern beauftragen Liu mit dem Bau eines Gedenkortes. In einem kleinen Park entwickelt der Architekt im Folgejahr ein Museum, das nur aus einem Raum besteht und äußerlich jenen Zelten ähnelt, die den Menschen in Sichuan als Notunterkünfte dienten. Betreten kann man den Raum nicht, nur durch ein Guckloch in der verschlossenen Tür Blicke in dessen ganz in Rosa, der Lieblingsfarbe des Mädchens, gehaltenes Inneres werfen. Ein Hocker steht hier, unter einem kreisrunden Fenster im Dach, an den Wänden hängen persönliche Gegenstände, die Hu Huishan gehörten, und Fotos, die sie mit Freunden und Familie zeigen. Ein verwaister Schreibtisch an der Wand macht deutlich, das hier ein Mensch fehlt, dessen Zukunft noch hätte geschrieben werden sollen und dessen Schicksal stellvertretend für den Schmerz einer ganzen Nation steht.
Film „West Village: A Megastructure, A Masterpiece“; The Pritzker Architecture Prize
In den Ausmaßen kaum größer und in den funktionalen Aneignungsmöglichkeiten kaum vielfältiger vorstellbar ist dagegen der „West Village“ genannte Superblock, den das Büro von Liu bis 2015 in Chengdu realisiert. Gebäude, Infrastruktur, Landschaft, öffentlicher Raum, Sportstätte und Naherholungsgebiet: In dieser Großstruktur wird all das eins. Geschäfte, Büros, kulturelle Einrichtungen und Multifunktionsräume umschließen einen öffentlichen Außenraum mit Gastronomie, Fußball- und Basketballplätzen und werden ihrerseits durch einen Rundweg verbunden, der sich über Rampen bis auf das Dach nach oben staffelt und als Laufstrecke inmitten der Stadt dient. Ein Haus, ja ein ganzes Quartier, für die Menschen.
Schreiben, Recycling, Ortsbezug
Dabei hört der Architekt nicht auf, neben dem Bauen auch zu schreiben. „Das Schreiben von Romanen und die Ausübung der Architektur sind unterschiedliche Kunstformen, und ich habe nicht absichtlich versucht, die beiden zu kombinieren“, so Liu. „Aber vielleicht aufgrund meines doppelten Hintergrunds gibt es in meiner Arbeit eine inhärente Verbindung zwischen beiden – wie etwa die erzählerische Qualität und das Streben nach Poesie in meinen Entwürfen.“ Zum geschriebenen Werk gehören „Narrative Discourse and Low-Tech Strategy“ (China Architecture & Building Press, 1997), „Now and Here“ (China Architecture & Building Press, 2002), „I Built in West China?“ (Today Editorial Department, 2009) und „The Conception of Brightmoon“ (Times Literature and Art Publishing House, 2014), die alle bis dato nicht in deutscher Übersetzung vorliegen.
Infolge des Erdbebens von 2008 entwickeln Liu Jiakun und seine Mitstreitenden ein Verfahren, um aus dem Schuttmaterial der zerstörten Häuser neue Leichtziegel herzustellen. „Rebirth-Bricks“ nennen sie die Steine, „Wiedergeburtsziegel“ – ein Name, der deutlich macht, wie sehr die Wiederverwendung von Materialien auch immer das Fortschreiben von Geschichten der Menschen ist, denen wir begegnen. „Das Restaurieren von Materialien ist immer auch die Wiedergeburt von Emotionen“, sagt Liu. Zum Einsatz kommen diese Steine unter anderem im Shuijingfang-Museum, das bis 2013 in Chengdu realisiert wird. Bestehende Holzbauten einer Spirituosen-Fabrik werden mit einer Betonstruktur umfangen, die mit lokalem Holz und eben jenen „Rebirth-Bricks“ ausgefacht wird. Ein weitläufiger Innenhof fasst die neuen zweigeschossigen Gebäude zu einem Ensemble, durch dessen Satteldächer, gezielt eingesetzt, die Sonnenstrahlen einfallen und so die alten Keller, Brennöfen und Relikte aus der Ming- und Qing-Dynastie erlebbar machen.
Film „Materials as Memory“; The Pritzker Architecture Prize
Liu Jiakun, der – neben zahlreichen anderen nationalen und internationalen Preisen – im Jahr 2022 auch mit dem German Design Award geehrt wurde, ist derzeit Gastprofessor an der School of Architecture Central Academy of Fine Arts (Peking, China) und hat zuvor an der Cité de l’architecture et du patrimoine in Paris, dem MIT in Cambridge/USA, und der Royal Academy of Arts in London gelehrt. Er lebt und arbeitet weiterhin in Chengdu, der Stadt, in der er geboren wurde.
Die Hinwendung zum Ort als architektonischem Ur-Element und zu den Geschichten, die wir mit ihm verbinden, würdigt nun auch die Jury des Pritzker-Preises: „Identität hat sowohl mit dem Individuum als auch mit dem kollektiven Gefühl der Zugehörigkeit zu einem Ort zu tun. Liu Jiakun greift die chinesische Tradition auf, ohne nostalgischen Ansatz oder Zweideutigkeit, sondern als Sprungbrett für Innovation“, heißt es in der Begründung des Preisgerichts. „Er schafft eine neue Architektur, die gleichzeitig ein historisches Dokument, ein Stück Infrastruktur, eine Landschaft und ein bemerkenswerter öffentlicher Raum ist.“