Wie sprechen wir über Räume und die gebaute Stadt, wie gestalten wir sie, mit welchen Prämissen und auf welchen Grundlagen tun wir das? Drei neue Publikationen geben Einblicke.

Philippe Koch, Stefan Kurath, Simon Mühlebach, ZHAW Institut Urban Landscape (Hg.): Figurationen von Öffentlichkeit Herausforderungen im Denken und Gestalten von öffentlichen Räumen. 128 Seiten, 160 Abbildungen 19,5 × 31,4 cm, 39 Euro
Verlag Triest, Zürich, 2021
Es ist erstaunlich, in welchem Missverhältnis das Reden über den öffentlichen Raum zu den qualifizierten Beobachtungen steht, die über seine Gestaltung, seine Wirkung, seine Akzeptanz angestellt werden. Meist werden bereits bekannte Rezepte vorgestellt, entwickelt an alten Städten, Rezepte für Plätze und deren Gestaltung, die dort unter ganz anderen Rahmenbedingungen als den heutigen entstanden sind. Für viele der Orte, die heute die Städte prägen, sind diese Rezepte untauglich, sie lassen sich darauf schlicht nicht anwenden. In diesem Buch wird hingegen das Ziel verfolgt, „den öffentlichen Raum neu zu sehen und auch zu beschreiben zu lernen“, wie die Autoren betonen.
Dazu haben sie sich vier Orte in Bern, Winterthur, Wallisellen und Frauenfeld ausgewählt, die mit Anspruch gestaltet, und nahe an Alltagswelten der Menschen sind: in einem neuen Geschäftsviertel; unter einer Autobahnbrücke an einem Knotenpunkt des ÖPNV; als ein stadtnaher Freiraum sowie auf einem Konversionsareal. Das an der ZHAW entwickelte Projekt setzt aktuelle Theorien über die Konstitution von Raum mit der konkreten Beobachtung der Nutzung und Gestaltung zueinander in Beziehung. Es werden verschiedene Arten unterschieden, wie Menschen einzeln oder in Gruppen den Raum hervorbringen, prägen, ihn nutzen, miteinander in Kontakt treten. Dabei wird – was ebenfalls in der Literatur über den öffentlichen Raum selten ist – die Balance gehalten zwischen den gestalterischen Elementen, der Bedeutung und Wirkung, die ihnen zugeschrieben werden kann einerseits, und den sozialen und gesellschaftlichen Praktiken andererseits. Oberflächen, Bepflanzung, Wegeführung, Schwellen, Kontaktaufnahme, Gruppendynamiken, Integration und Aneignung werden gleichermaßen erfasst und in die Analyse einbezogen. Wohltuend ist das große Bemühen um eine vorurteilsfreie Beobachtung, um eine, die nicht schon von Vermutungen und Unterstellungen ausgeht.
Acht Erkenntnisse beschließen das erfrischende und dennoch lehrreiche Buch – das mit der plausiblen, nachvollziehbaren und eigentlich erschreckenden Beobachtung schließt: „Die Auseinandersetzung mit Öffentlichkeit und öffentlichen Räumen im 21. Jahrhundert ist nicht nur in der Forschung, sondern auch in der Praxis vernachlässigt worden.“ Diese Lücke wird nur zu schließen sein, wenn Forschung und Praxis sich gleichermaßen dem Thema in der Offenheit annehmen, in der dies hier geschehen ist.
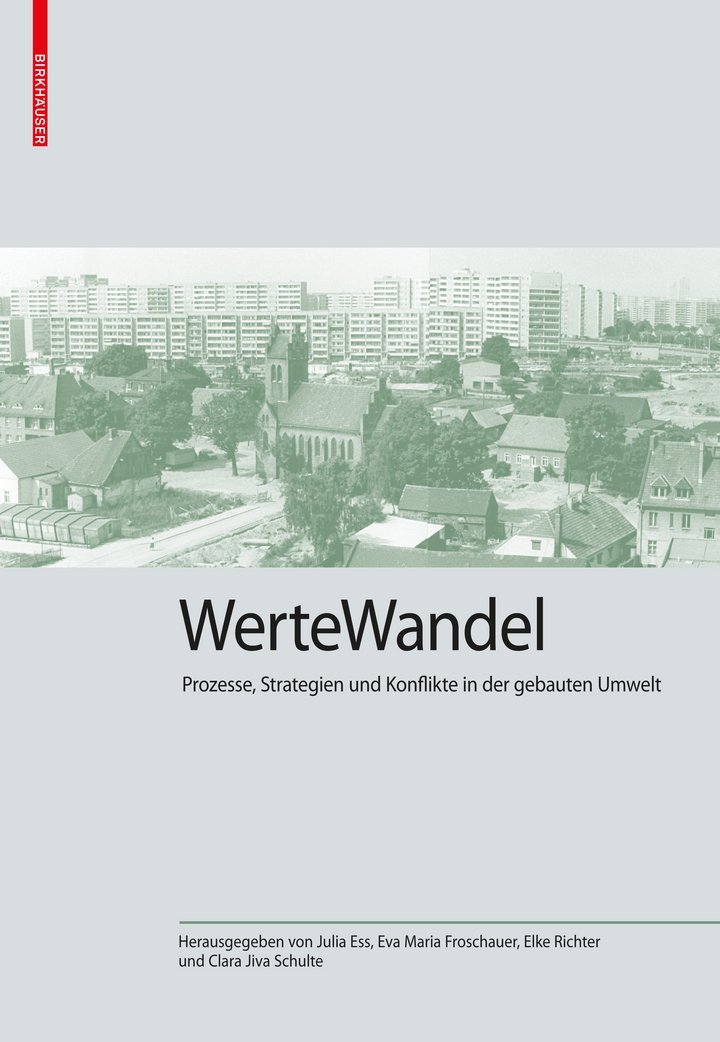
Julia Ess, Eva Matia Froschauer, Elke Richter, Clara Jiva Schulte (Hg.): WerteWandel. Prozsse, Strategien und Konflikte in der gebauten Umwelt. 211 Seiten, 75 Abbildungen, 17×24 cm, 49,95 Euro
Birkhäuser Verlag, Basel, 2021
Werte sind beim Bauen eine große Hilfe. Sie rahmen Entscheidungen so, dass die unerschöpfliche Menge des Möglichen bewältigt werden können, dass Entscheidungen überhaupt getroffen werden können. Werte sind dabei nie statisch. Das sind alleine noch keine überraschenden Erkenntnisse. Interessant wird es dann dort, wo der Wandel von Werten sich noch nicht vollzogen hat, obwohl erkannt ist, dass tradierte veraltet sind, und dort, wo verschiedene Wertevorstellungen konkurrieren. Es sind solche Fälle, die in diesem Buch behandelt werden, einer weiteren Publikation im Rahmen des Graduiertenkollegs „Kulturelle und technische Werte historischer Bauten“.
Gegliedert in fünf Themenfelder, wird der Frage nachgegangen, wie sich die internalisierte Wertevorstellungen ebenso wie die im Diskurs reklamierten im Umgang mit der gebauten Umwelt niederschlagen, wie sich Wertzuschreibungen ändern und wie Konflikte selbst dann entstehen, wenn die sich gegenüberstehenden Protagonisten auf gleiche Begriffe beziehen.
Im einzelnen sind die Beiträge in fünf Kapitel gefasst: in Wertebegriff und Wertentstehung (1), Wertewandel (2), Instrumentalisierung, Vermittlung und Medialisierung (3), gesellschaftliche Dynamiken und soziale Praktiken (4) sowie die politische Rekontextualisierung und Umwertung von Bauten (5). Da finden wir die These von Gerhard Vinken bestätigt, dass die Altstadt ein Projekt der Moderne ist (Moritz Röger), da zeigt sich, dass sich sowohl Befürworter der Rekonstruktion des Neuen Museums in Berlin wie die, die sich für eine Neuinterpretation und zeitgemäße Ergänzung stark machten, auf die Geschichte als Wert bezogen: Wertekonflikt ohne Wertekonflikt (Jochen Kibel). Auch Stephanie Herold erkennt ein gemeinsames Fundament bei Freunden der vormodernen Nostalgie wie bei denen der Großbauten aus den 1960er und 1970er Jahren, insofern als beide die Gegenwart als unzulänglich wahrnehmen.
Und schließlich ist auch der Verweis darauf, wie unterschiedlich die Auseinandersetzungen in fachlicher Hinsicht im Gegensatz zur Wahrnehmung von Laien sein können. Achim Hahn weist auf die Lücke zur Alltagswahrnehmung hin, die Wissenschaftler:innen dadurch erzeugen, dass sie die emotionale Komponente in der Wahrnehmung von Architektur auf Distanz halten. Auch die zwei Beiträge zum Taksim-Platz und zum Atatürk Kulturzentrum, (das zwar abgerissen wurde, aber in ähnlicher Form wiederaufgebaut werden soll) legen dar, dass sich in den breiten Massen der Werteantagonismus nicht in der Schärfe ausmachen lässt, der den Diskurs bestimmt hatte. Und der Taksim-Platz trotz fortwährender Umgestaltung ein Ort des Widerstands und der Solidarität geblieben ist. So stellen sich viele überraschende und bereichernde Querbezüge zwischen den einzelnen Beiträgen her – etwas, das in einer Anthologie nicht immer zu finden ist.

Andrea Benze, Dorothee Rummel (Hg.): Inklusionsmaschine STADT. Inklusion im Städtebau, interdisziplinär diskutiert. 208 Seiten, 30 Abbildungen, 17 x 24 cm, 35,00 Euro
Jovis Verlag, Berlin, 2020
Eine Anthologie der weniger üblichen Art ist auch die von Andrea Benze und Dorothee Rummer herausgegebene Publikation „Inklusionsmaschine Stadt“. Sie geht von Werkstattgesprächen aus, in denen Expert:innen ihre Sicht auf die Inklusion im Städtebau austauschten – und dabei auch durchaus unterschiedlicher Meinung gewesen sein konnten. So waren Nina Gribat, Architektin und Stadtplanerin und der Kommunikationspsychologe Michael Häfner nicht darüber einig, was wichtiger sei: Regulierung oder das Einfordern moralischen Handelns. Den vier transkribierten Werkstattgesprächen schließen sich Essays der am jeweiligen Gespräch beteiligten Personen an – so wird die Lebendigkeit, die die Gespräche ausstrahlen mit der Tiefe, die dort nicht erreicht werden kann, kombiniert.
Der Titel sei, so ist es im Vorwort der Herausgeberinnen zu lesen, als Provokation gedacht – sie solle zum Widerspruch herausfordern. Den legen die Herausgeberinnen gleich selbst ein: Inklusion auf ein technisches Problem zu reduzieren, reiche nicht aus: „Denn selbst wenn alle baulichen Barrieren beseitigt sind, ist die Stadt nicht automatisch inklusiv.“ Was damit konkret gemeint ist, wird in den vier Kapiteln erörtert. So verweist Cordelia Polinna vom Büro Urban Catalyst darauf, dass der angespannte Wohnungsmarkt erade für Menschen mit Behinderungen besonders problematisch ist, Stephan Reiß-Schmidt erwähnt, dass in den Inklusions-Beiräten zu oft die einen, die in ihm vertreten sind, bezahlt werden, die anderen aber nicht. Nina Gribat bemüht die Analogie zum deutschen Schulsystem, das erst einmal für alle zugänglich sei, „aber am Ende haben wir doch keinen sozialen Aufstieg, weil in unserer Gesellschaft eben doch der soziale Hintergrund das verhindert.“ Auch an anderer Stelle wird der systemische Zusammenhang bemüht – etwa beim Thema des Designs, das ein Produkt noch so gut gestalten könne, etwa einen Rollstuhl, wenn aber das Auto weiterhin privilegiert behandelt werde, blieben die Hindernisse, die aus dieser Logik erwachsen, so die Transformationsdesignerin Saskia Herbert.
Das Buch endet mit neun „Ansatzpunkten für eine inklusive Stadt“, die eher wie eine Zusammenfassung denn wie eine Handlungsanleitung funktionieren. Klar, wenn es darin beispielsweise heißt, dass Bürger:innen in einer inklusiven Stadt Ambivalenzen aushalten müssten und eine inklusive Stadt bedeute, Privilegien aufzugeben, dann ist noch nicht gesagt, was das im konkreten Handeln zu bedeuten hat, auch wenn die Sicht auf manche komlexe Lage etwas deutlicher geworden sein mag. Die Stadt ist eben doch keine Inklusionsmaschine, an der nur die richtigen Knöpfe gedrückt werden müssten.


