Im Rahmen des Bundesprogramms »Zukunft Bau« wurde auf einem Symposium nach Alternativen zu einem technikzentrierten Umgang mit der Klimakrise gesucht. Es sollten „robuste, einfache und vor allem suffizienzorientierte Lösungswege für einen nachhaltigen Transformationsprozess im Gebäudebereich“ diskutiert werden. Ändern müsse sich fast alles – aber wann ändert sich tatsächlich etwas?
Sehr facettenreich und anregend, kontrovers und streckenweise auch recht radikal war das Spektrum an Input-Vorträgen des Fachsymposiums „Lowtech Bau“, mit dem Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) und das Natural Building Lab der TU-Berlin nun zum dritten Mal technikzentrierte Effizienzstrategien und alternative Lösungswege zum Erreichen der Klimaschutzziele im Gebäudebereich zur Diskussion stellte. Der Begriff „Suffizienz“ stand dieses Mal im Fokus der Veranstaltung, die am 7. Juni 2024 in den Räumen des Instituts für Architektur der TU Berlin entlang dreier Panels zu Raum, Material und Gebrauch unsere Lebenspraktiken und Erwartungen an Gebäudeperformance nachhaltig zu hinterfragen wagte. Etwas, was vor allem die junge Generation an Planenden heute besonders zu bewegen scheint, die in sehr großer Zahl und mit erkennbar großem Engagement zum Symposium gekommen war.
»Imperiale Lebensweise«
Enttäuscht wurden sie nicht. Robert Kaltenbrunner vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung setzte mit seiner Eröffnungsrede über eine „Bauwende“ gleich zu Beginn klare Handlungsaufforderungen, was sich im Bereich Bauen, Planen und Leben verändern müsse, nämlich fast alles: die Fördermittellogiken, die Aufgabenstellungen, das Bauen weg vom Neubau hin zum Bestand, die Umsteuerung des Planens mittels Flächen-Zertifikate hin zu integral nachhaltigeren wie auch sozialeren Projekten. Atemlos folgte man seiner inhaltlich sehr dichten Rede, die im Gegensatz zu vielen anderen, in letzter Zeit erklärten „Wenden“ klar Wege und Mittel und nicht nur weit entfernte Ziele benannte. Ergänzt um den Vortrag von Annika Hock, einer jungen Forscherin des BBSR und Mitorganisatorin der Tagung, die danach den Begriff Suffizienz mit all seinen Implikationen erklärte, wurde jedoch deutlich, um was es an diesem Tage gehen würde, nämlich um ein sehr kritisches Hinterfragen unserer Konsum- und Produktionspraktiken hin zu konsistenteren und resilienteren neuen Bau- und Lebensweisen.
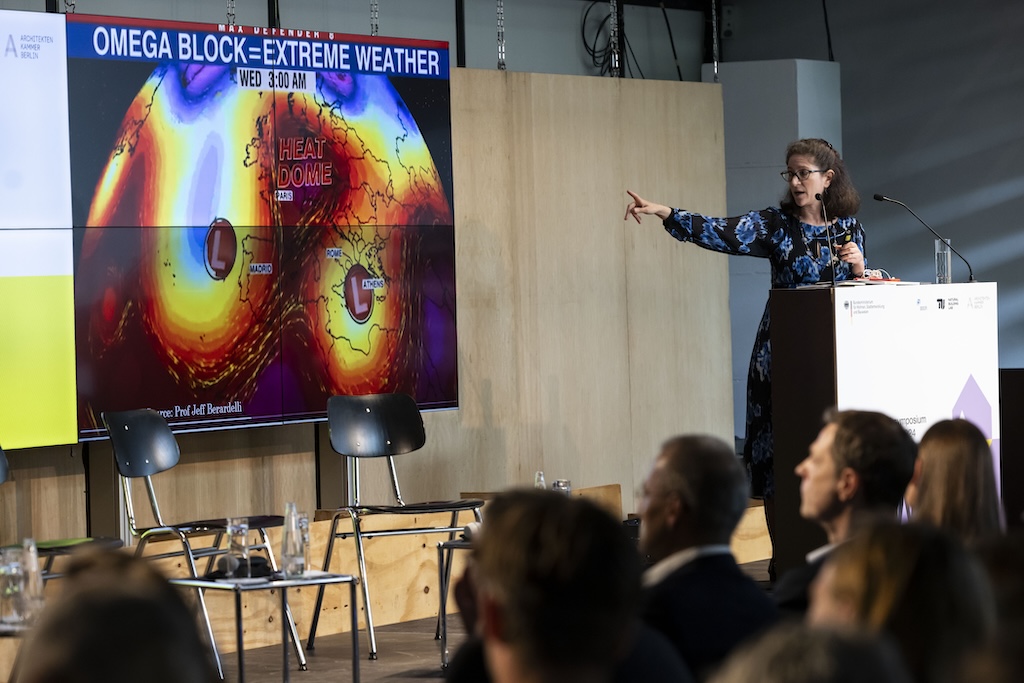
Räumte mit dem Mythos vom „grünen Wachstum“, auf: Julia Steinberger.
Credit: bundesfoto / Christina Czybik

Unsere Lebensweise ist eine teure geworden – und eine, deren Kosten zum geringsten Teil die Schadensverursacher tragen. Im Bild: Anton Brokow-Loga (Bild: © bundesfoto | Christina Czybik)
Julia Steinberger, die an der Universität Lausanne den Lehrstuhl Ökologische Ökonomie bekleidet, schloss bruchlos mit ihrer Rede „Living well within limits“ mit vielen empirischen Studien an Annika Hocks Rede an. Erstaunlich scharf räumte sie mit vielen Allgemeinplätzen in der Klima- und Energiediskussion auf: Angefangen von dem Terminus „grünes Wachstum“, der nichts anderes sei als ein „greenwashing“, da das Wirtschaftskonzept Wachstum Nachhaltigkeit eher verhindere als möglich mache, da nun einmal die Ressourcen auf unserer Erde begrenzt seien. 15 Quadratmeter Wohnfläche pro Kopf seien zum Beispiel die Grenze des ökologisch Möglichen. Und nur durch eine gerechtere Verteilung und einen gleichberechtigten Zugang zu Ressourcen könnten die Menschen von einer Wende unserer Lebensweisen überzeugt werden.
Noch viel stärker kritisierte Anton-Brokow-Loga von der Bauhaus-Universität Weimar und dem I.L.A. Kollektiv unsere Wohnansprüche in Europa im folgenden Panel Raum. Als eine „imperiale Lebensweise“ bezeichnete er sie, die Wohnen und Bauen nur auf Kosten anderer betreiben könne. Angesichts der weiterhin dramatisch hohen Produktion von Emissionen, die unser Bauen verursache, müssten wir vor allem unsere mentalen Einstellungen und Infrastrukturen schonungslos hinterfragen und verändern. Am Beispiel Berlins und des Tempelhofer Feldes analysierte die Mobilitäts-Soziologin Michaela Christ vom Deutschen Institut für Urbanistik unsere ausgeuferten Flächenansprüche wie etwa den Zuwachs an Siedlungsfläche seit 1992 um 25 Prozent oder die Zunahme von PKWs um mehr als 60 Prozent. „Umkämpfter Raum“ werde immer mehr den Alltag unserer Städte prägen, wenn nicht unser Ressourcenverbrauch deutlich durch ein Abrissmoratorium, die Abschaffung aller Neubau-Förderung, Wohnraumbörsen und Belegungsvergaben, neue Wohnraumkonzepte und Konzeptverfahren eingeschränkt werde.

Gustav Düsing bot in seinem Vortrag eine greifbare Vision einer positiveren Zukunft(Bild: © bundesfoto | Christina Czybik)
Handlungsdefizite und Waldschäden
Welche Qualitäten durch Verzicht und bewusste Selbstbeschränkungen erreicht werden könnten, blieb dem Vortrag des Architekten Gustav Düsing überlassen, dessen Studierenden-Pavillon der TU Braunschweig kürzlich den Mies van der Rohe Award for European Architecture erhielt. Nach vielen harten Worten und erschreckenden Szenarien bot er den Teilnehmern des Vormittagsprogramms erstmals eine greifbare Vision einer positiveren Zukunft mit weniger Ressourcenverbrauch, aber deutlich anderem Komfort. Ohne die Bedeutung der voran gegangenen Vorträgen schmälern zu wollen, konnte man sich hier zeitweise schon in ein arg reformatorisches Kollegium strengster Observanz versetzt fühlen, das unerbittlich anhand vieler wissenschaftlicher Datenmengen nurmehr einen möglichen Lösungsweg des Verzichts zeichnete. Unter vielen Gleichgesinnten kam leider oft der Dialog zu kurz, wie etwa das Gewünschte und Notwendige an Reformen aus dem Kreis der Wissenschaftler und Fachleute tief in die Gesellschaft, Politik und Bauherrenschaft überwechseln und angenommen werden kann, ohne die der gewünschte Wandel hin zu nachhaltigeren Bau- und Lebensweisen kaum umsetzbar sein dürfte. Oder wie es ein Zuhörer anmahnte: „Es gibt heute kein Wissensdefizit mehr, sondern es gibt allein ein sehr großes Handlungsdefizit.“

Holz ist für das Bauen kein Allheilmittel. Die Hoffnungn in diesen Baustoff sind eher Greenwishing. Im Bild: Susanne Winter (Bild: © bundesfoto | Christina Czybik)
Wie groß dieses Handlungsdefizit ist, machte nachmittags im Panel Material Susanne Winter vom WWF erschreckend deutlich. Unter dem Titel „Holz – Potenzial und Versprechen“ führte sie vor Augen, dass das neue Heilsmaterial Holz bislang keineswegs für eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft stehe. Es werde aktuell immer noch mehr Holz geschlagen als neu angepflanzt und dieses zudem unter dem Label „erneuerbare Energie“ auch immer mehr sinnlos verheizt. Klimaneutral seien somit Gebäude aus Holz noch lange nicht, zumal die Schäden an den vorhandenen Wäldern weltweit deutlich zunehmen würden. Ihr Fazit: Holz könne unseren Bedarf an Baumaterial in Zukunft ergänzen, aber kaum in dem gewünschten Umfang ersetzen.
Erfrischend selbstkritisch und viel Mut machend, war hingegen der Vortrag von Ben Pohl von der Denkstatt sàrl, der Schwesterorganisation vom bekannteren Baubüro in situ/Basel. Unter dem Titel „Big Size Matters“ reflektierte er die Grenzen, aber auch neuen Möglichkeiten von Re-Use und Kreislaufwirtschaft als Mittel gegen Ressourcenverschwendung. Neue Narrative und integrierte Labore des Bauens seien für eine erfolgreiche Bauwende unumgänglich, um vor allem mehr neue Partner zu finden. Überschaubar in greifbaren Schritten entwarf er ein sehr komplexes Bild von einem neuem Bauen im Bestand, das bereits heute möglich ist, indem es die bestehenden Regelwerke kreativ und kommunikativ neu interpretiert. Eine Haltung, die auch von Margit Sichrowsky vom Berliner Architekturbüro LXSY geteilt wurde, deren Vortrag stärker das Rethinking von Standards behandelte.
Gesundheit, Glück und Klagen
Grundsätzlicher wurde es wieder im Panel Gebrauch, das von der Architekturpsychologin Alexandra Abel aus Weimar eingeleitet wurde und sich sehr unterhaltsam den menschlichen Bedürfnissen widmete. „Weiter wie bisher ist keine Option“, wenn wir Gesundheit und Glück als unsere Lebensziele anstreben. Aktuell würden jedoch Leugnen und Verdrängen das Handeln vieler dominieren, das nur durch einen tiefgreifenden mentalen Wandel unseres Verhaltens zur Realität überwunden werden könne. Aus Umwelt müsste nun mehr eine Mitwelt werden, Anpassung an die Stelle von Aneignung treten, was vor allem eine kluge Selbstbeschränkung des Subjekts erfordere. Das Subjekt müsse sich mehr definieren „als Teil von etwas, das Sinn ergibt und selbst Sinngebend“ sein könne. Wofür sie nicht unumstritten in der Diskussion unter Verweis auf einen ungarischen Theoretiker eine stärkere Selbstbeschränkung individueller Kreativität und Experimente einforderte, deren unkontrollierten Ergebnisse uns in die heutige Lage gebracht hätten. Oder verkürzt: Mehr dänisches Hygge als Ego sei heute wünschenswert.
Wie gesund Selbstbeschränkung sein kann, war danach ideal ergänzend das Thema des Vortrags von Runa T. Hellwig, einer Expertin für Bauklimatik an der Universität Aalborg. Sehr informativ nahm sie sich den Temperaturpraktiken in Vergangenheit und Gegenwart an, die sich in den letzten 160 Jahren in Europa erheblich veränderten. Empfand man Mitte des 19.Jahrhunderts noch eine Zimmerwärme von 18 Grad Celsius als ideal, so steigerte man diese bis in die 1970er-Jahre auf 23 Grad Celsius. Mit der Folge, dass damit nachweislich manche Zivilisationskrankheiten wie Adipositas deutlich zunahmen. Verzicht auf modernen Komfort könne also weniger ein Verlust als ein Gewinn an Gesundheit angesehen werden – eine sehr interessante Erkenntnis, die Suffizienz in Form von Energiesparen vielleicht größere gesellschaftliche Akzeptanz verschaffen könnte.

Nanni Grau; im Bild das Konzept zum Umgang mit der Mannheimer U-Halle. (Bild: © bundesfoto / Christina Czybik)
Nanni Grau vom Berliner Architekturbüro Hütten & Paläste, die kürzlich den neu eingerichteten Lehrstuhl für Architektur der Transformation an der TU-Berlin erhielt, setzte nach einer langen Reihen von Vorträgen den Schlusspunkt. Ihr Thema? – Eine neue Architektur für fluide Nutzungen mit minimalen Interventionen, die sehr konkret viel Suffizienz mit Zirkularität und Partizipationen verbindet. Viele Pionierprojekte mit gewiss noch begrenzter Reichweite und Übertragbarkeit, aber immerhin ein positiver Ausblick auf eine bessere Zukunft, die mehr Resilienz und Suffizienz im besten Sinne von Lowtech verspricht.
Ernüchternd fiel dagegen die Abschlussdiskussion aus, die versuchte, Suffizienz und die Vorträge des Tages in größere Zusammenhänge zu setzen. Einmal mehr wurde hier viel und zweifellos klug über die gewünschte Bauwende mit den damit verbundenen Veränderungen gesprochen, über fehlenden Wohnungsbau, Institutionen und Instrumente. Doch keiner der Podiumsdiskutanten kam über eine Situationsbeschreibung mit vielen kleinen Veränderungsschritten hinaus, insbesondere nicht die Vertreter des Bundes, von BMWSB und Bundestag, die allzu oft nur ihre begrenzten Kompetenzen für das Bauen und die Schwerfälligkeit unseres föderalen Systems beklagen konnten. Allein Anja Bierwirth vom Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie brachte noch einen wichtigen Aspekt in die Diskussion ein, der viel zu selten im Symposium Beachtung fand, nämlich die soziale Dimension der Bauwende, die mehr als ein „Wunschkonzert“ erhebliche Verantwortungsverlagerungen und Verteilungsprobleme nach sich ziehen kann. Vielleicht das Thema des nächsten Lowtech-Symposiums, das dann aber auch andere Akteure des Bauens und Planens in den Bundesländern oder der Bauwirtschaft miteinbeziehen sollte, um das Defizit des Handelns direkter und breiter überwinden zu helfen.



