Die Gestalt der Stadt zeichnet sich heute mehr als jemals zuvor durch Vielfalt aus. In dieser synchronen Präsenz verschiedener Ideen kommt ein Abbild unserer Gesellschaft zum Ausdruck. Das dichte Nebeneinander unterschiedlicher Zielvorstellungen ist sogar zum Symbol für Urbanität geworden. Das bedeutet aber auch, dass Stadt, anders als ein einzelnes Gebäude, keinen abgeschlossenen Zustand erreichen kann – sie lässt sich nicht als Bild oder Kunstwerk komplettieren. Aber wie bildet man Stadt in einem anspruchsvollen Entwurf ab? Welche Zusammenhänge sind relevant und wie lassen sich Parameter der Stadt von heute definieren?
„Städtebau.Positionen“ (11) | Die Serie versteht sich als öffnender Beitrag zum Diskurs über Stadt, als Panorama der städtischen Vielfalt und Themen, mit denen umzugehen wir herausgefordert sind.
Das fortwährende Wachstum der Städte legt nahe, von einem Erfolgsmodell dieser Form des Zusammenlebens zu sprechen. Dass die Disziplin des Städtebaus von diesem Wachstum profitiert, lässt sich aber nicht unbedingt behaupten. Beim städtebaulichen Entwerfen stellt sich die prinzipielle Frage, ob es sinnvoll ist, alle auf dem Gebiet der Stadt anfallenden Gestaltungsaufgaben im Zusammenhang zu sehen und ob es möglich ist, für sie kohärente Leitlinien festzulegen. Oftmals wird dies schon dadurch verhindert, dass die Entscheidungsprozesse, die städtebaulichen Planungen zugrunde liegen, so viele Interessen, Gestaltungsansichten und Meinungen vereinigen müssen, dass am Ende ein Ergebnis des kleinsten gemeinsamen Nenners auch gestalterisch banal wird und kaum mehr ist als ein den Marktmechanismen entsprechendes Ergebnis.
Stadtgestaltung in der Krise?
Die pluralistische Gesellschaft lässt sich ganz offensichtlich nicht ohne Weiteres in eine pluralistische Stadtgestalt übersetzen; ein nicht durch Planung, sondern durch andere Umstände entstandenes, heterogenes Stadtbild entspricht nicht unserer Vorstellung von Stadt im Sinne einer zusammenhängenden „lesbaren“ Gestalt. Handelt es sich also um ein Defizit unserer Demokratie, welches wir als Dilemma akzeptieren müssen? Angesichts aktueller Debatten um die Stadt, den Ergebnissen von städtebaulichen Verfahren bis hin zu den aus ihnen hervorgegangenen, demokratisch ausgehandelten und gebauten Versatzstücken, lässt vermuten, dass sich für den Städtebau kaum noch allgemeine Leitlinien formulieren lassen. Oder sind unsere Vorstellungen solcher allgemeiner Leitlinien nur zu sehr auf formale Homogenität konzentriert?
Klassische, auf Homogenität basierende Leitbilder haben durchaus weiterhin Erfolg, zumeist in den streng abgegrenzten Bereichen, die der Entwicklung privater Investoren überlassen werden. Der Film „Truman Show“ karikierte Ende der 1990er Jahre trefflich die heile Welt des New Urbanism, bei dem es sich oftmals um segregierte Gated Communities handelt, die in den letzten Jahren vermehrt auch in Mitteleuropa unter dem Deckmäntelchen der vermeintlich historischen Stadt als homogene und vom Kontext isolierte Quartiere entstehen.
Das pragmatische Gegenteil homogener Stadtbilder ist die kleinteilige Mischung vieler Ideen nebeneinander. Eine ungeregelte Mischung verschiedenster Baukörper wirkt aber letztlich ästhetisch laut, das einzelne Gebäude trägt nichts zu einer verbindenden Gestaltung bei. Der Stadtraum kann so kaum dem Anspruch genügen, Raum der Gemeinschaft und Begegnung zu sein. Dieses Defizit wird, wenn es denn erkannt wird, dadurch kompensiert, dass der Stadtraum so aufdringlich gestaltet wird, dass man meint, er sollte das öffentliche Leben erzwingen. Kurzum: Gebiete dieser Art lassen Selbstverständlichkeit und Normalität vermissen.

Homogene, durch Architektur artikulierte Stadtbilder oder eine pragmatische Mischung sind nur eingeschränkte Haltungen zur zeitgenössischen Stadt. (Bilder: Volker Kleinekort)
Weder die homogenen Inseln noch die pragmatische Mischung können also dem gesellschaftlich integrativen Potenzial von Städten gerecht werden, und auch nicht ihrer gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und sozialen Komplexität. Solchen Planungen fehlt die zeitliche Offenheit, die Offenheit, um eine spätere Entwicklung aufnehmen zu können, die nicht vorhergesehen werden kann. Gerade heute, wo sich Urbanität mehr als je zuvor durch das dichte Nebeneinander unterschiedlicher Zielvorstellungen definiert, liegt der Schlüssel zu einem zeitgemäßen Städtebau in einer Mischung, welche die Vielfalt bereits ansatzweise abbildet und mit den unverwechselbaren Gegebenheiten des Ortes verknüpft.
Stadt als additive Ordnung
Gefragt ist ein Städtebau mit einer offenen additiven Ordnung. Dies verstehen wir als Vermittlung im Nebeneinander bei der Durchdringung unterschiedlicher Ideen. Dabei werden zum Teil alte Ordnungen überschrieben, ohne diese auszulöschen und ihre Elemente oder Teile davon in neue, geordnete Zusammenhänge gebracht. Diese überlagern sich mit spezifischen, auf den Ort bezogenen, ausgewählten Festlegungen. Damit sind aber keine starren, übergeordneten Leitbilder gemeint, obschon diese Festsetzungen auch sehr konkret und formal ausfallen können. Der Begriff der offenen additiven Ordnung schließt die unterschiedlichen Maßstabsebenen des Städtebaus ebenso ein wie die Zeit als vierte Dimension der Stadt. Denn sowohl der Raum als auch die Zeit sind für die Qualität des Städtebaus von wesentlicher Bedeutung. Auf den unterschiedlichen Maßstabsebenen – Haus, Baufeld, Quartier, Stadtteil – sollte jede Einheit stets erkennbar und ablesbar sein. Damit sich Menschen in der Stadt intuitiv orientieren können, reicht es nicht, sich auf eine dieser Ebenen zu konzentrieren, sie müssen in einem Bezug zueinander stehen. Hier setzt das Prinzip der additiven Ordnung an, welches nicht nur visuell, sondern bestenfalls über möglichst viele Sinne wahrnehmbar wird. Stadt ist gleichzeitig immer und nie „fertig“. Sie als einen permanenten sich in der Zeit vollziehenden Prozess zu verstehen, forciert das additive Prinzip, fordert aber darüber hinaus ein großes Maß an Offenheit und Unbestimmtheit ein.
Diese offene Ordnung ist insofern von Bedeutung, als zahlreiche aktuelle Städtebauprojekte eher den Charakter eines zu komplettierenden Bildes haben. So, als könnte man die Stadt eben doch fertig bauen, folgen die Entwürfe einer homogenen räumlichen, formalen und vor allem programmatischen Logik. Sie sehen zwar aus wie Stadt, sind aber bloß Siedlung – homogen in den Typen und Milieus. Sie sind nicht selten vom Kontext abgekoppelt, was um so schwerer wiegt, als sie sich oftmals nicht in Randlagen befinden, sondern direkt in die städtische Struktur eingebunden sind. Es fehlt ihnen die dem Begriff der additiven Ordnung implizite Differenz, die sich als formale und funktionale Mischung verstehen lässt. Dabei reicht es nicht, hier und da etwas Gewerbe zuzulassen, oder den kommunal festgeschrieben Anteil an förderfähigem Wohnungsbau zu erfüllen. Vielmehr sollte neben der Nutzungsmischung auch eine typologische, soziale und kulturelle Mischung das Ziel sein.
Warum gelingt das so selten? Es ist für Investorinnen und Investoren, Planerinnen und Planer sowie Aufsichtsbehörden selbstverständlich viel einfacher, homogene Bau- und Nutzungsstrukturen zu realisieren, da sie sonst einen höheren Abstimmungsaufwand zu bewältigen haben. Differenz erzeugt Mehrarbeit über den gesamten zeitlichen Verlauf vom Beginn der Planung bis zur Realisierung, die nur schlecht im Voraus kalkulierbar ist. Das gilt sowohl für kleinere wie für große Projekte. Letztere sind zudem für Störfeuer von politischer Seite wesentlich anfälliger.

Große Quartiere gehören schon seit einigen Jahren wieder zu den Aufgaben von Städtebau und Stadtplanung. (Wien, Seestadt Aspern, Bild: Björn Severin)
Nun könnte man entgegnen, dass größere Projekte selten sind, die Aufgaben des Städtebaus in Mitteleuropa eher im Kleinen zu finden sind, es also um die Anschlussfähigkeit einzelner Teile an ein größeres, schon bestehendes Ganzes geht. Dem stehen aber aktuelle Wachstumsprozesse entgegen und damit verbunden immer größere Aufgaben für den Städtebau. Nachdem eine Phase der Innenentwicklung durch die Umwidmung von Kasernen- oder Industriearealen weitestgehend abgeschlossen scheint, aktivieren die Kommunen in den letzten Jahren immer größere neue Flächen. Die Verfahren zum Frankfurter Nordwesten, Augsburg Haunstetten oder Freiburg Dietenbach für jeweils mindestens 20.000 neue Einwohner sind nur drei von vielen Beispielen der letzten Jahre.
Wenn also die Frage aufkommt, ob wieder Großsiedlungen gebaut werden müssten, dann muss man darauf antworten, dass dies schon längst wieder der Fall ist, es wird vielfach nur anders bezeichnet, nämlich als „Quartier“ oder gar als „neuer Stadtteil“ – dennoch müsste man je nach Planung von Siedlungen sprechen, die der Stadt gegenüberstehen. Die Stadt jedoch der Siedlung vorzuziehen, erzeugt nicht nur Mehraufwand, es erfordert zunächst einmal Mut bei der Erarbeitung der Entscheidungsvorlagen. Nutzungsmischung und die damit verbundenen Aushandlungsprozesse, Dichte und die Integration lokaler Produktion sowie ein anderes Mobilitätsverhalten sind nicht „einfach so“ zu haben.
Stadtbilder
Die Wiederentdeckung des Leitbilds der europäischen Stadt reduziert die komplexe Vielfalt tatsächlicher europäischer Städte auf eingegrenzte Bildwelten und formale Lösungsansätze. Dem steht die beschriebene „offene additive Stadt“ gegenüber. Anders als in der Architektur, in der Entwurfsverfasser eindeutig zu identifizieren sind (deren individuelle Leistung auch für alltägliche Aufgaben allerdings erst seit dem frühen 20. Jahrhundert als solche anerkannt wird), ist diese eindeutige Form der Autorenschaft bezogen auf die Stadt ungewöhnlich. Denn hier gibt es nicht das eine „Werk“, keinen fertigen Status, sondern immer nur sich überlagernde Strukturen, die zeitlich aufeinander folgende Phasen des Städtebaus sichtbar und erlebbar machen. Aber diese fortlaufende Veränderung der Stadt muss geplant und choreographiert werden. Und genau das erscheint im Projektalltag als Problem – die Akteure ziehen sich auf Einzelfelder zurück: Sie planen Prozesse oder moderieren Beteiligungsverfahren, entwerfen Strukturen oder konzentrieren sich auf Materialfragen in Gestaltungssatzungen.
Aber allein in Prozess- und Beteiligungsverfahren, in Fachdisziplinen und externen Gutachten, wird die zu Beginn aufgeworfene Frage nach der Stadt als zusammenhängendem Gestaltungsfeld nicht beantwortet. Das Einbinden der Nutzerinnen und Nutzer, einschließlich eines mitunter inszenierten Particitainments, ist gesellschaftlich sicher richtig, bietet aber nur einen Teil dessen, was städtebauliche Planung zu berücksichtigen hat, da sie sich ausschließlich auf die Erfahrungen des „Jetzt“ konzentriert. Stadtentwicklung muss aber als prozessuales Handeln auf eine mögliche Zukunft verstanden werden. Hier setzt auch ein anderes Verständnis von Städtebau an. Denn die gebaute Stadt macht das Prozessuale nicht nur programmatisch, sondern vor allem auch strukturell und formal sichtbar. Stadt als offene additive Ordnung wird zum Gestaltungsanspruch.
Urbane Kontingenz
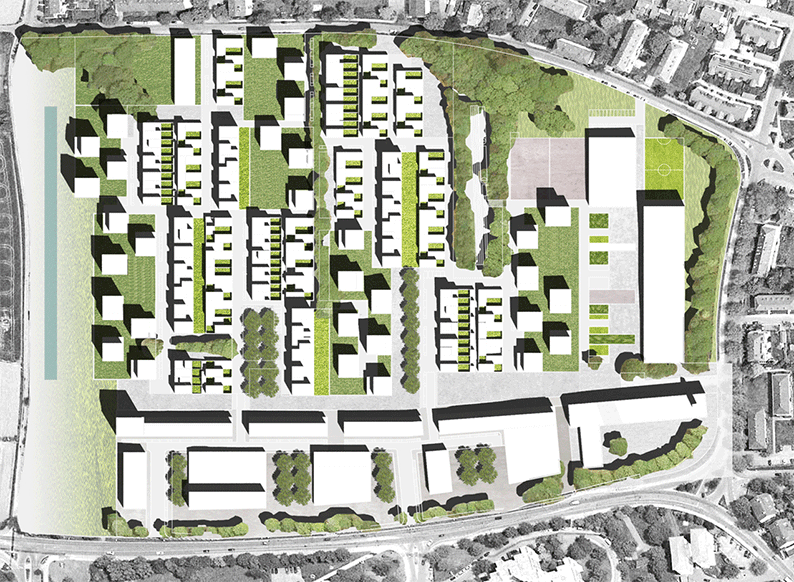
Wir kennen unsere Zukunft nicht – deswegen müssen wir sie in konkreten Szenarien entwerfen. (Bild: rheinflügel severin / bueroKleinekort)
Die zeitliche Dimension mitzuentwerfen, stellt den Anspruch, auf nicht vorhersehbare Entwicklungen zu reagieren. Zeit als strategische Komponente im Entwurf geht aber weit über den Horizont von Baufolgen und Baustufen hinaus. Vielmehr ist es von entscheidender Bedeutung, einen flexiblen Plan zu entwerfen – flexibel in seinen unterschiedlich möglichen Entwicklungsstufen und seiner damit zusammenhängenden späteren Umsetzung. Bei der Entwicklung eines Quartiers können sich die Parameter im Laufe seiner Entstehung ändern. Planung sollte strategisch so konzipiert sein, dass diese Eventualitäten bereits als Szenarien im Entwurf angelegt sind. So müssten Baufelder beispielsweise so dimensioniert werden, dass unterschiedliche Bebauungstypologien, vom Geschosswohnungsbau bis zu Reihen- oder Hofhäusern in sich gegenseitig bestimmenden räumlichen Bezügen umsetzbar sind. So wie wir heute mit unserem Tun auf Bestehendes aufbauen, ist das jetzt Entworfene die Grundlage zukünftiger Entwürfe. Wir entwerfen das Hier und Jetzt und formulieren zugleich auch eine Anschlussfähigkeit in die Zukunft. Veränderungen können in der Logik der additiven Ordnung den Entwurf weiterführen. Wir verstehen das Räumlich-Prozessuale im städtebaulichen Entwurf als konkrete Umsetzung der Erwartung an Stadt, Identität und Differenz abzubilden.
Denn alle Ebenen der additiven Ordnung – Haus, Baufeld, Quartier, Stadtteil – brauchen beide Aspekte, benötigen jeweils Wiedererkennbarkeit (räumliche Identifikation) und Unterscheidung (baulichen Differenz). Dieses Wechselspiel aus den beiden, auf den ersten Blick vermeintlichen Gegensätzen, ist das Rückgrat in einem räumlichen Entwurf. Das gilt es in jedem Entwurfsprojekt neu festzulegen und im größeren Zusammenhang zu verankern. Denn Stadt muss im Sinne von Antizipation nicht geplant sondern zu allererst entworfen werden!


