In Stadt und Architektur materialisieren sich Vorstellungen vom guten Leben – Stadt und Architektur setzen den Rahmen dafür, wie Menschen leben können. Drei neue Bücher eröffnen sehr unterschiedlichen Perspektiven auf die Potenziale des Gebauten.
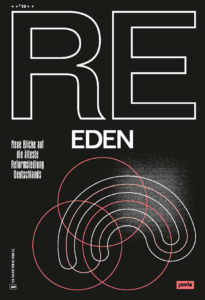
Re:Form e. V. (Hg.): Re:Eden. Neue Blicke auf die älteste Reformsiedlung Deutschlands. Eine Publikation von bankleer und Dietrich Heißenbüttel. 144 Seiten, 13 x 19 cm, 18,00 Euro
Jovis Verlag, Berlin, 2019
1893 wird in der Nähe Berlins die Genossenschaft „Vegetarische Obstkolonie Eden“ gegründet, um eine lebensreformerische Siedlung zu errichten. Die Pioniersiedlung für Gartenstadtbewegung, naturnahes Leben und geteilten Besitz ist heute nur noch wenig bekannt, auch wenn sie – wenngleich nicht unbeschadet – die Zeitläufte als „Eden“ bis heute überstanden hat. Die Gedanken, die der Siedlung zugrunde liegen, wurden in einem Projekt zum 125-jährigen Bestehen auf ihre Aktualität überprüft, als Re:Eden liegt zu diesem Unternehmen nun die Publikation vor. Sie spannt den Bogen der geschichtlichen Einordnung hinsichtlich Bodenreformen und Reforminitiativen von Bezügen zu Henry George bis zum Mietshäusersyndikat. Künstler, Architekten und engagierte Bewohner entwickelten Ideen für die Fortschreibung des Reformgedankens unter den Vorzeichen unserer Zeit, die hier vorgestellt werden. Dabei sind die Autoren sehr darauf bedacht, auf die Rolle der Bewohnerschaft zu verweisen: alle Impulse von außen, die auf die Chancen verweisen, die Siedlung mit ihren Gedanken als vorbildlich in unseren prekären Zeiten weiterzuentwickeln, muss von innen heraus kommen. Vorschläge werden einige gemacht: wie die Siedlungsstruktur so verändert werden könnte, dass wieder mehr Gemeinschaftsflächen entstehen, wie die Brennnessel zum wirtschaftlichen Standbein werden könnte, wie Eden eine Ausbildungsstätte werden könnte, in denen gelernt werden kann, wie Lebensmittelanbau mit gemeinschaftlichen Lebensformen organisiert werden könnte. Temporäre Rauminstallationen, Kunstprojekte und Feste haben dafür gesorgt, dass in der Siedlung ein Aufbruchsgeist entstand. Noch ist nicht gewiss, wie er fruchtbar gemacht werden kann. Die Voraussetzungen freilich sind günstig, die Ressourcen sind vorhanden. Es könnte sich lohnen, auch in Zukunft immer mal wieder zu überprüfen, was sich in Eden tut.
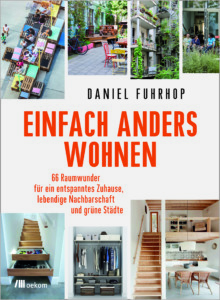
Daniel Fuhrhop: Einfach anders wohnen. 66 Raumwunder für ein entspanntes Zuhause, lebendige Nachbarschaft und grüne Städte. 128 Seiten, 14, 00 Euro
oekom Verlag, München, 2019
„Einfach anders wohnen“ nennt Daniel Fuhrhop sein neues Buch, das 66 „Raumwunder“ verspricht. Die Raumwunder sind eine Sammlung von Anregungen, wie man mit weniger Platz auskommen kann, wie er sinnvoll und teilweise auch gemeinsam genutzt werden kann. Dem Buch liegt der Gedanke zugrunde, dass vieles einfacher würde, wenn alle ein bisschen oder auch gerne ein bisschen mehr Platz sparen: wir bräuchten dann kleinere Wohnungen, könnten andere in unsere aufnehmen, gewönnen Platz auf der Straße, schonten die Umwelt, trügen dazu bei, dass Häuser nicht abgerissen werden. Zu den Raumwundern gehören nicht nur Tipps, wie man entrümpelt oder seine Wohnung besser nutzt, sondern auch Beispiele für Umbauten, Untervermietungen, Co-Working, Clusterwohnungen, Wohnungstausch, Hausgemeinschaften. Alles scheint einfach, man muss es nur tun. Und viel Wahres ist dran: Wir verschwenden Platz, den wir nicht benötigen, aber beheizen; wir beheizen Räume, in denen Dinge stehen, die wir nicht brauchen. Mit bisweilen viel Pathos („Zusammen gewinnen wir Nähe, Freundschaft und Liebe“) werden die einzelnen Anregungen vorgetragen, in einer Kürze freilich, die in vielen Fällen nur eine erste Anregung ist, sich auf die Suche nach Alternativen zum gepflegten Lebensstil zu machen. Immerhin helfen umfangreiche Quellenangaben.
Der hoffnungsmachende Ton, der uns Glück verspricht, uns auffordert, loszulassen und die Fantasie zu aktivieren, liest sich freilich oftmals etwas wie einen Ratgeber zur Behandlung von Luxusproblemen, zum Weg zu sich selbst oder anderen Bewusstseinserweiterungen versprechenden Erkenntnishilfen. Teilen kann aber nur, wer genug hat. Der Hinweis, dass für eine Yogamatte auch im Gefängnis Platz sein, ist schon etwas zynisch. Wie weit die Selbstverpflichtungshoffnungen tragen, erleben wir derzeit – nicht sehr weit. Gute Projekte und Aufforderung zum Handeln sind richtig; ohne in den politischen Kontext eingebettet zu sein, wirken sie dann doch etwas wie die Nachrichten aus einer fernen, heilen Welt. Aber gerade dort dürfte ruhig auch etwas von denen erzählt werden, die mit politischen und wirtschaftlichen Entscheidungen alles zunichte machen, was der Einzelne sich abringt.

Michael Meier, Christoph Franz (Hg.): Der Durchschnitt als Norm. 260 Seiten, 12 x 19 cm, 26,00 Euro
Spector books, Leipzig, 2018
Ganz anders gehen die beiden Künstler Michael Meyer und Christoph Franz vor. „Der Durchschnitt als Norm“ kann als Affront, als Appell, als Analyseprämisse verstanden werden – und genau mit dieser Vieldeutigkeit spielt die Sammlung der Texte und Interviews, die als Teil eines künstlerischen Projekts erschienen ist. Stadt als Sediment kultureller, politischer, wirtschaftlicher Entwicklungen, als Voraussetzung neuer Initiativen ebenso wie als ästhetisches Objekt, ein unbestimmbares Ganzes, das durch Neubewertung immer wieder in Bewegung versetzt werden und darin den Raum für neue Realitäten öffnen kann.
Den Durchschnitt anzuerkennen ist eine Methode, eine Wirklichkeit in Augenschein zu nehmen, ohne sie sofort bewerten zu müssen, provoziert gleichwohl gleichzeitig den Wunsch, die Norm zu verschieben, um eine andere Wirklichkeit denkbar werden zu lassen. Soziologen, Planer, Urbanisten, Künstler kommen zu Wort, sie suchen nach den Lücken in veralteten Konzepten von Stadt, die neue Freiheiten eröffnen, verweisen auf die reibungsvolle Aneignung von Stadt, die Kommunikation und neue Ideen hervorbringt. Sie diskutieren über neue Wohnformen und eine Faszination der Großsiedlung, die Erfahrung von Gewalt und Widerstand, die abgelegten Formen des Fortschritts wie Hochstraßen. Sie machen sich Gedanken über Partizipation und die Potenziale, Leere nicht mit Gestaltung zu füllen, sondern sie den Alltagspraktiken der Bewohnerschaft zu öffnen. Fast gewinnt man zwischenzeitlich den Eindruck einer Beschwörung: dass man doch endlich wahrnehme, dass die Stadt wegen ihrer Regeln Freiheit schafft, dass sie Freiräume trotz der sie durchdringenden Ökonomisierung bietet, so wie heute in dem, was zunächst auf Funktion getrimmt wurde.
Die Arbeit der beiden Künstler übrigens besteht in einem zu einem Krangewicht von über einer Tonne Gewicht, das auch tatsächlich als solches eingesetzt wurde. Eine zur Norm gepresste Geschichte, die Voraussetzung für Neues werden kann, ohne es vorherzubestimmen. Es ist nicht entschieden, ob Besseres kommen wird.

