Die Stadt ist Lebensraum für immer mehr Menschen. Wie man Stadt erklären kann, wie wichtig der öffentliche Raum ist, welchen Einfluss und welche Möglichkeiten Architektinnen und Planerinnen haben und hatten – das sind die Themen vier neuer Bücher.

Osamu Okamura (Autor), David Böhm, Jiří Franta (Illustrationen: Die Stadt für alle. Handbuch für angehende Stadtplanerinnen und Stadtplaner, 176 Seiten, 21 x 26 cm, 25 Euro
Karl Rauch Verlag, Düsseldorf, 2022
Was heißt Stadt? Wer plant sie, warum ist sie so, wie sie ist, welche Konflikte werden in ihr ausgetragen und wie könnte ihre Zukunft aussehen? Was ist der öffentliche Raum? Wie entsteht soziale Segregation, wie kann man städtische Mobilität organisieren? Osamu Okamura, Architekt und Dekan der Fakultät für Kunst und Architektur der TU Liberec, hat ein Buch geschrieben, das auf diese Fragen Antworten gibt. Es wurde als „Familienbuch“ angekündigt, was es besser charakterisiert als die Bezeichnung „Handbuch für angehende Stadtplanerinnen und Stadtplaner“, wie es nun heißt; denn es wird auch Menschen Freude machen, die die Stadt nicht zu ihrem Beruf machen wollen.
Und das ist gut so. Es erklärt in einer allgemeinverständlichen Sprache, wie eine Stadt funktioniert, und welche Entwicklungen sie prägen. Okamura macht deutlich, warum Shoppingcenter ein Problem sind, warum Menschen in die Vororte ziehen und dass es falsch ist, zu sagen, wir hätten keinen Platz für Fahrradwege: Wir haben nur fast alles davon den Autos überlassen. Okamura hat den Mut zu den Vereinfachungen, die man braucht, um verständlich zu werden – und dennoch wird sein Text nie banal.
Das Buch ist illustriert mit wunderbaren Zeichnungen im Stil einer Grafik Novel von Jiří Franta, und mit Fotos von Modellen David Böhms. Diese Modelle lassen nie einen Zweifel daran, dass sie Modelle sind und arbeiten dennoch nicht mit den üblichen Abstraktionen, die uns sonst aus den Stadtmodellen vertraut sind. Sie zeigen, dass sie mit einfachen Mitteln, mit Pappe, Knetgummi, gemacht sind, dass die Fassaden aufgeklebt oder mit Bleistift gezeichnet sind. Im Hintergrund sieht man das Zimmer, in dem sie aufgebaut sind. So erzählen sie Geschichten, ohne auf einen konkreten Fall reduziert werden zu können. Sie haben eine Leichtigkeit, weil sie die Virtuosität, mit der sie gebaut wurden, verbergen. Zeichnungen und Modelle öffnen so den Weg, den Okamura für die Zukunft der Stadt als den entscheidenden ansieht: dass alle, die in ihr wohnen und sie benutzen, dazu ermuntert werden, ihren Lebensraum Stadt mitzugestalten: Das Buch macht Lust auf Stadt. Zurecht wurde das Buch letzte Woche mit dem DAM Preis für die besten Architekturbücher ausgezeichnet.
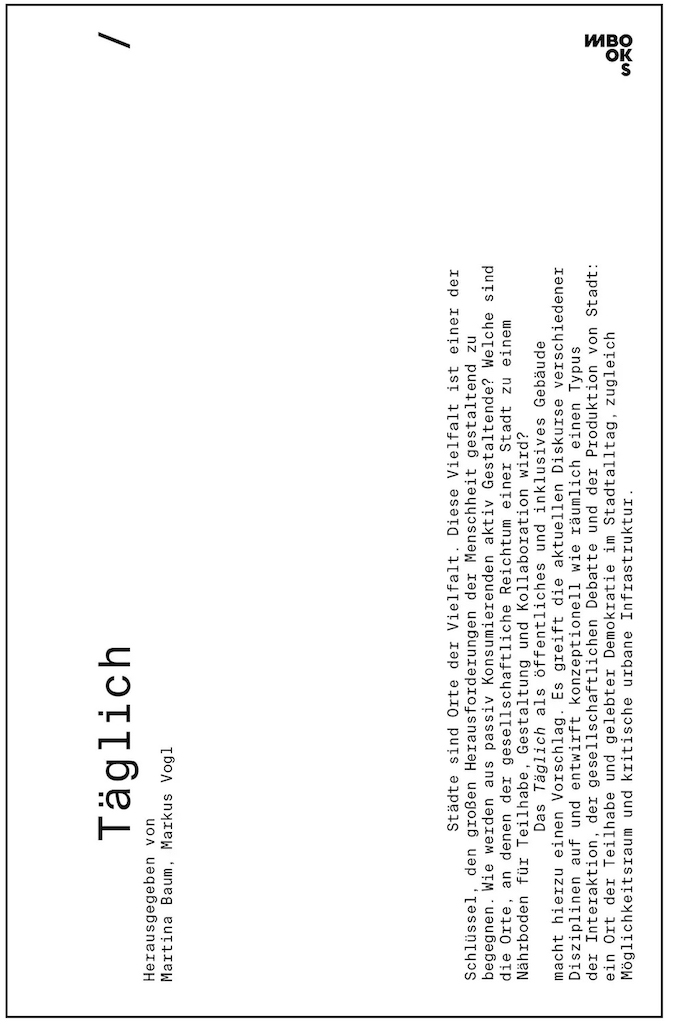
Martina Baum, Markus Vogl: Täglich. Warum wir Öffentlichkeit, öffentlichen Raum und öffentliche Gebäude brauchen. 228 Seiten, 11 × 17 cm, zahlreiche Abbildungen, 20 Euro
M Books, Weimar, 2022
Auch im von Martina Baum und Markus Vogl herausgegebenen Buch „Täglich“ heißt es, dass jeder Bewohner, jede Bewohnerin einer Stadt als Teil der Stadtgesellschaft befähigt und berechtigt sei, diese mitzugestalten. Ihre Publikation „Täglich“ schlägt vor, einen neuen Haustyp zu etablieren, der geeignet ist, sich an der Schnittstelle zwischen privater Wohnung und dem öffentlichen Freiraum als Alternative zu den viel zu oft nur über den Umweg des Konsums zugänglichen Treffpunkten und Aufenthaltsräumen zu etablieren.
Dieser Haustyp soll allen zugänglich sein und im Unterschied zur Vielzahl öffentlicher Gebäude, die bereits bestehen, nicht lediglich einer bestimmten Gruppe oder einem eng definierten Programm entsprechen. Ein solches Haus nennen Baum und Vogl „Täglich“, weil es in der Alltagswelt verankert ist und das Alltagsleben bereichert: „Entlang der Alltagswege kann es beiläufig entdeckt und Ort spontaner Begegnungen werden.(…) Ein Besuch im Täglich kann aber auch zur Routine werden, eine Gewohnheit, die – fest verankert im Alltag – Orientierung und Anregung gleichermaßen bietet“, heißt es etwa. Anhand von insgesamt 22 Begriffen wird die Qualität dieses Täglich beschrieben: Sie heißen beispielsweise „Vertrauen“, „Schwelle oder „Improvisieren“ – das macht deutlich, dass dieser Haustyp nicht über seine architektonische Struktur, sondern über sein Programm und seine Verflechtung im Quartier definiert ist und sich damit auch je nach Kontext unterschiedlich ausprägen soll. In einem Essay wird dieses Konzept des „Täglich“ im Diskurs und der Theorie der Stadt verankert. Entstanden aus einem Forschungsprojekt in einer Kooperation des Städtebau-Instituts der Universität Stuttgart und dem Walter-Gropius-Lehrstuhl des DAAD an der Universidade de Buenos Aires, sind im Buch die Grundlagen der Idee eines Raums für die Öffentlichkeit ausdrücklich als ein Impuls für weitere Diskussionen, für weitere Initiativen angelegt.
Ganz neu ist die Idee nicht: Es gibt Vorbilder und Häuser, die diese Ansprüche bereits in bestimmten Aspekten einlösen; 34 von ihnen werden im Buch vorgestellt. Sie reichen vom Fun Palace (Cedric Price und Joan Littlewood, 1964) über den Parc de La Vilette (Bernhard Tschumi, 1982–98), die Londoner Idea-Stores (verschiedene Architekt:innen, seit 1999) und der Stadtbücherei Oodi in Helsinki (ALA Architects, 2018) bis hin zum Poupatempo von Paulo Mendes de Rocha und anderen in Brasilien, das verschiedene Nutzungen, kostengünstige Konstruktion, Flexibilität und öffentliche Zugänglichkeit in einer 300 Meter langen Struktur miteinander verbindet. Für die Diskussion um die drohende (oder bereits existierende) Spaltung der Gesellschaft ist hier ein Grundstein dafür gelegt, mit konkreter Intervention gegenzusteuern.

Arnold Bartetzky, Nicolas Karpf und Greta Paulsen (Hg.): Architektur und Städtebau in der DDR. Stimmen und Erinnerungen aus vier Jahrzehnten. 270 Seiten, 21-23 cm, zahlreiche Abbildungen, 28 Euro
Dom Publishers, Berlin, 2022
Die Geschichte und der Architektur des Städtebaus in der DDR sei lange Nischenthema gewesen sei, was sich aber mittlerweile gründlich geändert habe, schreibt Arnold Bartezky in der Einleitung zum diesem Band. In elf Interviews bringt diese Publikation die Baugeschichte der DDR plastisch und lebendig den Lesenden aus der Innenperspektive nahe. Damit wird das Ziel verfolgt, die Zusammenhänge, Handlungsspielräume und Netzwerke, den Rahmen, innerhalb dessen in der DDR gebaut und geplant wurde, durch Zeitzeugen anschaulich zu machen und auch auf die Erfahrungen einzugehen, die nach 1990 von den Interviewten gemacht wurden.
2017 und 18 wurden die Gerspräche geführt; dass sie nun erst, 2022, publiziert wurden, ist der sehr sorgfältigen Aufarbeitung geschuldet, die in einem umfangreichen Fußnotenapparat die Personen, Projekte, Redewendungen, die in den Gesprächen genannt werden, zuordnet und um Literaturhinweise ergänzt.
Seinen Ausgang nahm dieses Projekt in der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung, die nicht nur die Leistungen der Interviewten kritisch würdigen wollte, sondern auch ihre Überlieferungen für zukünftige Forschung sichern wollten. Um dem Anspruch eines solchen Projekts gerecht zu werden, wurde die Unterstützung des Instituts für Kunstgeschichte der Universität Leipzig in Anspruch genommen, auch, weil sich die Initiatoren des Projekts bewusst waren, dass ihnen die Zeit davon laufen könnte. Dass sich das Zeitfenster für die Dokumentation mündlicher Überlieferung zu schließen beginnt, wurde etwa dadurch deutlich, dass einer der Interviewten, Winfried Sziegolteit, Anfang 2021 verstarb.
Zu den Interviewten gehören Architektinnen wie Martha Döhler-Bezardi oder Heike Scheller, die 1990 noch am Anfang ihrer Laufbahn standen, prägende Personen wie die Chefarchitekten der Stadt Leipzig (Dietmar Fischer) und des Leipziger Baukombinats (Frieder Hofmann), ein Denkmalpfleger (Wolfgang Hocquél), der Theoretiker Bruno Flierl und der Kritiker Wolfgang Kil, sowie mit Michael Bräuer der Baustaatssekretär der letzten DDR-Regierung. Man erfährt, wie das Studium war, wie Stellen besetzt wurden, unter welchen Bedingungen gearbeitet wurde, wie Entscheidungen getroffen wurden. Man liest von den Erfolgen, von Widerständen, davon, dass Aufträge auch mal am Biertisch vergeben wurden, wie sehr Improvisationstalent gefragt war. Berichtet wird von ernüchternden Erlebnissen und der kritischen Sicht auf die getroffenen Entscheidungen: Man könne mit Plattenbauten keine Altstadt reparieren, meint etwa Houcquél. Johannes Schulze bezeichnete es als „Irrtum seines Lebens“, als „überzeugter DDR-Bürger“ geglaubt zu haben, im Gegensatz zur Bundesrepublik komme in der DDR der Profit allen zugute. Bartezky weist darauf hin, dass viele der Interviewten die Handlungsspielräume innerhalb des Regimes explizit hervorgehoben hätten. Und auf einen Nachtrag von einer der Zeitzeuginnen, Angela Wandelt, die meinte, die Bewertungen wären anders ausgefallen, hätte man die gefragt, die in der DDR scheiterten und nicht in ihrem Beruf tätig blieben, stellt Bartezky vage in Aussicht, dass diese Anregung einmal aufgegriffen werden könnte. Aber dass man nun erst einmal froh sei, „den Band endlich in die Hände der Leserinnen und Leser legen zu können.“
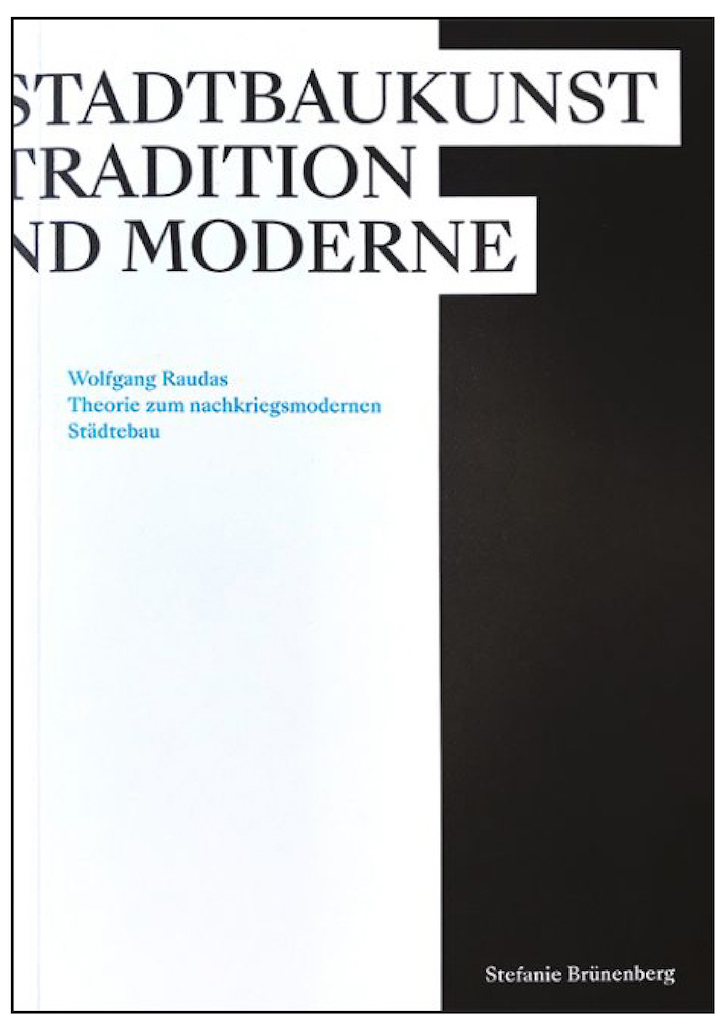
Stefanie Brünenberg: Stadtbaukunst zwischen Tradition und Moderne. Wolfgang Raudas Theorie zum nachkriegsmodernen Städtebau. 400 Seiten, 17 x 24 cm, Fotografien, Pläne und Zeichnungen, 32 Euro
Urbanophil, Berlin, 2021
Wolfgang Rauda dürft den meisten Planer:innen kaum bekannt sein. Stefanie Brüneberg ist seinen Spuren im Rahmen einer Dissertation nachgegangen. Rauda, geboren in Zittau, studierte er in Dresden und ein Semester in Stuttgart, promovierte in Dresden, wo er zunächst als Mitarbeiter beim dortigen Denkmalplfeger Ermisch tätig war; bis 1945 war er unter anderem in den polnischen Gebieten, die die Deutschen nach dem Überfall 1939 besetzt hatten, als Regierungsbaurat tätig. In Dresden wirkte er nach 1945 bis 1958, unter anderem seit 1952 als Professor für Wohnungsbau und Entwerfen, floh dann in die Bundesrepublik, wo er zunächst als Architekt und 1968 bis zu seinem Tod 1971 das Lehrgebiet „Lebendige städtebauliche Raumbildung“ betraute.
Im Mittelpunkt von Brünenbergs Publikation stehen die wenig rezipierten Beiträge Raudas zur Städtebau-Theorie, die er insbesondere in Schriften der 1950er und 1960er Jahre niedergelegt hat. In ihnen nimmt er eine eigene Position zwischen den konservativen, auf Rekonstruktion zielenden Positionen und den Modernen ein, etwa, in dem er stets an der Raumwahrnehmung durch den Fußgänger festhielt. In seinem Werk lassen sich Einflüsse wie die Sittes, aber auch von Kevin Lynch – die er offensichtlich nicht sauber referenzierte – deutlich ausmachen. Rauda steht in seiner Arbeit als ein Beispiel für einen Teil aus Architektenschaft und Städtebau, die sich um eine Vermittlung zwischen den Polen Rekonstruktion und radikalem Neuanfang bemühten – er ist, so Brünenberg, damit auch ein Beispiel dafür, dass der These Nerdingers widersprochen werden könne, dass noch in Jahrzehnten, als der Wiederaufbau der deutschen Städte als abgeschlossen galt, das Bedürfnis nach Geschichte lediglich von Laien asugegangen sei. Gleichwohl nahm Rauda damit auch Positionen ein, die mit dazu beitrugen, dass er in beiden deutschen Staaten nur schwer Fuß fassen konnte.
Brünenberg stellt Rauda einschließlich seines bis zum Schluss nicht deutlich distanzierten Verhältnisses zum Nationalsozialismus in den Kontext der Theorien und Diskurse seiner Zeit und lenkt so einen bereichernden Blick auf die Entwicklungen des Städtebaus der Nachkriegszeit. Brünenberg zeigt, dass die Geschichte sich in wesentlich mehr Zwischentöne auffächert, als dies in Geschichtsdarstellung sichtbar ist, die sich auf die wirkmächtigen Hauptlinien konzentrieren muss.

